Zusammenfassung
- Definition:Dilatation und/oder Hypertrophie sowie ggf. Dysfunktion des rechten Ventrikels als Folge einer pulmonalen Hypertonie.
- Häufigkeit:Vorliegen bei ca. 5–10 % der Herzerkrankungen.
- Symptome:Belastungsdyspnoe, Müdigkeit, Leistungsintoleranz, Husten, Angina, Synkope.
- Befunde:Halsvenenstauung, periphere Ödeme, auskultatorisch 3. Herzton und Geräusche von Trikuspidalklappeninsuffizienz/Pulmonalklappeninsuffizienz.
- Diagnostik:Echokardiografische Erfassung von Größe, Hypertrophie und Funktion des rechten Ventrikels sowie Abschätzung des pulmonalarteriellen Drucks. Ergänzende Untersuchungen zur Abklärung der pulmonalen Hypertonie (Spirometrie, HR-CT, Lungenszintigrafie, Labor inklusive BGA, Rechtsherzkatheter).
- Therapie:Behandlung der Grunderkrankung (v. a. Lungenerkrankungen und Linksherzerkrankungen) einer pulmonalen Hypertonie. Bei pulmonalarterieller Hypertonie gezielte drucksenkende Medikation. Bei CTEPH (chronisch thrombembolische pulmonale Hypertonie) Antikoagulation/Thrombendarterektomie und evtl. gezielte drucksenkende Medikation.
Allgemeine Informationen
Definition
- Cor pulmonale ist ein häufig verwendeter Begriff in der Literatur, allerdings ohne klare konsensuale Definition.1
- Im Allgemeinen versteht man unter Cor pulmonale die Dilatation und/oder Hypertrophie sowie ggf. Dysfunktion des rechten Ventrikels als Folge einer pulmonalen Hypertonie.
- In einer etwas engeren Definition wird der Begriff nur bei pulmonaler Hypertonie durch Erkrankungen von Lungen oder Thorax sowie von Störungen der pulmonalen Ventilation oder Zirkulation angewendet.
- Linksherzerkrankungen oder kongenitale Vitien als Ursache für die pulmonale Hypertonie sind in dieser Definition nicht berücksichtigt.2
- Ein Cor pulmonale kann akut auftreten (Lungenembolie), im Allgemeinen wird der Begriff aber für chronische Veränderungen von Struktur und Funktion des rechten Ventrikels verwendet.
Häufigkeit
- Cor pulmonale liegt vor bei ca. 5–10 % aller Herzkranken und ca. 10–30 % der stationär wegen Herzinsuffizienz Behandelten.
- Die genaue Inzidenz und Prävalenz der pulmonalen Hypertonie sind schwierig bestimmbar aufgrund der zahlreichen Erkrankungen mit möglicher pulmonaler Druckerhöhung.
- Prävalenz der pulmonalen Hypertonie ist global > 1 %, bei über 65-Jährigen ca. 10 %.4-5
- Tritt am häufigsten im Zusammenhang mit Lungen- und Linksherzerkrankungen auf.
- Lungen- und Linksherzerkrankungen sind etwa gleich häufig ursächlich für eine pulmonale Hypertonie.4
- Eine chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH) ist vermutlich unterdiagnostiziert mit Unterschätzung der Prävalenz.
- Prävalenz der pulmonalarteriellen Hypertonie (Gruppe 1, siehe Klassifikation) ca. 15–60/1.000.000 in Europa6
- Tritt am häufigsten im Zusammenhang mit Lungen- und Linksherzerkrankungen auf.
- Kann auch schon im Kindes- und Jugendalter auftreten.
- Häufigkeit einer pulmonalen Hypertonie bei Kindern (einschl. kongenitale Vitien) ca. 3,7/1 Mio.
Ätiologie und Pathogenese
- Voraussetzung für die Entwicklung eines Cor pulmonale ist ein erhöhter pulmonalarterieller Druck (pulmonale Hypertonie)
- Pulmonale Hypertonie ist definiert als mittlerer pulmonalarterieller Druck ≥ 25 mmHg.6
- Entscheidend ist die Messung in Ruhe! (Normwerte in Ruhe im Mittel ca. 14 ± 3 mmHg, obere Normgrenze ca. 20 mmHg)6
- Bestimmung des mittleren pulmonalarteriellen Drucks mittels Rechtsherzkatheteruntersuchung
- Echokardiografie ist aber die wichtigste Primäruntersuchung bei V. a. pulmonale Hypertonie (erfasst nicht den mittleren, sondern den systolischen Pulmonalarteriendruck!).
- Verschiedene pathophysiologische Mechanismen können eine pulmonale Hypertonie auslösen (z. B. Hypoxie mit reflektorischer Erhöhung des pulmonalarteriellen Widerstands), die letztlich zum Cor pulmonale führen kann.
- Den einzelnen pathopysiologischen Mechanismen können wiederum verschiedene Ätiologien zugrunde liegen (z. B. Hypoxie verursacht durch interstitielle Lungenerkrankungen, COPD, Schlafapnoe etc.)
Klassifikation
- Die klinische Klassifikation der pulmonalen Hypertonie erfolgt in fünf große Gruppen mit jeweils zahlreichen Untereinteilungen:7
- Gruppe: pulmonalarterielle Hypertonie (PAH)
- 1.1 idiopathisch
- 1.2 hereditär
- 1.3 Drogen und Toxine
- 1.4 assoziiert mit: Bindegewebserkrankungen, HIV, portaler Hypertonie, kongenitaler Herzerkrankung, Schistosomiasis
- Gruppe: pulmonale Hypertonie (PH) durch Linksherzerkrankung
- 2.1 systolische Dysfunktion
- 2.2 diastolische Dysfunktion
- 2.3 Klappenerkrankung
- 2.4 Obstruktion Einfluss-/Ausflusstrakt
- 2.5 andere
- Gruppe: pulmonale Hypertonie (PH) durch Lungenerkrankungen oder Hypoxie
- 3.1 COPD
- 3.2 interstitielle Lungenerkrankungen
- 3.3 andere Lungenerkrankungen mit Mischung aus Obstruktion/Restriktion
- 3.4 Schlafapnoe
- 3.5 Erkrankungen mit alveolärer Hypoventilation
- 3.6 Langzeitaufenthalt in großer Höhe
- 3.7 Entwicklungsstörungen der Lunge
- Gruppe: chronische thrombembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH) (und andere Gefäßobstruktionen)
- 4.1 chronische thrombembolische pulmonale Hypertonie
- 4.2 andere pulmonalarterielle Obstruktionen
- Gruppe: pulmonale Hypertonie (PH) mit unklaren und/oder multifaktoriellen Mechanismen
- hämatologische Erkrankungen
- Systemerkrankungen
- metabolische Erkrankungen
- andere
Prädisponierende Faktoren
- Prädisponierende Faktoren für Grunderkrankungen, die sekundär zu pulmonaler Hypertonie und Cor pulmonale führen (z. B. Rauchen als prädisponierender Faktor für COPD)
ICD-10
- I26 Lungenembolie
- I26.0 Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
- I27 Sonstige pulmonale Herzkrankheiten
- I27.0 Primäre pulmonale Hypertension
- I27.1 Kyphoskoliotische Herzkrankheit
- I27.2 Sonstige sekundäre pulmonale Hypertonie
- I27.8 Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten
- I27.9 Nicht näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheit (chronisches Cor pulmonale)
Diagnostik
Diagnostische Kriterien
- Klinisches Erscheinungsbild
- Vergrößerter und/oder hypertrophierter rechter Ventrikel in der Bildgebung (üblicherweise Echokardiografie)
- Nachweis einer pulmonalarteriellen Druckerhöhung
Differenzialdiagnosen
- Kardiomyopathien
- Linksherzinsuffizienz
- Konstriktive Perikarditis
- St. n. Rechtsherzinfarkt
- Pulmonalstenose
- Rechtsherzinsuffizienz bei angeborenen Herzerkrankungen
Anamnese
Aktuelle Anamnese
Vorgeschichte
- Erkrankungen, die mit pulmonaler Hypertonie einhergehen können (siehe Abschnitt Ätiologie und Pathogenese), z. B.:
Klinische Untersuchung
Untersuchungsbefunde, die auf pulmonale Hypertonie/Cor pulmonale hinweisen
- Linksparasternale Pulsation
- Dritter Herzton
- Betonter Pulmonalisanteil des II. Herztons
- Pansystolikum 4. ICR rechts oder links (Trikuspidalklappeninsuffizienz)
- Diastolikum 2. ICR links (Pulmonalklappeninsuffizienz)
- Gestaute Halsvenen
- Hepatomegalie
- Periphere Ödeme
- Aszites
Untersuchungsbefunde, die auf Grunderkrankung hinweisen
- Tiefstehende Zwerchfelle, leises Atemgeräusch bei COPD/Lungenemphysem
- Zeichen eines postthrombotischen Syndroms bei St. n. TVT
- Lungenstauung bei Linksherzinsuffizienz
- Adipositas bei Schlafapnoe-Syndrom, adipositasbedingter Hypoventilation
- Etc.
Ergänzende Untersuchungen in der Hausarztpraxis
EKG
- Siehe auch Artikel EKG, Checkliste.
- Sinustachykardie
- Vorhofflimmern/-flattern, atriale Tachykardien
- P-Pulmonale
- Lagetypveränderungen
- Rechtsverschiebung der elektrischen Herzachse
- S1Q3-Typ oder S1S2S3-Typ
- Rechtsschenkelblock
Sonografie Abdomen
- Abklärung Lebererkrankung/portale Hypertonie
- Erfassung von Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz (gestaute V. cava/Lebervenen)
Labor
- NT-proBNP, BNP
- Erhöhung bei Patient*innen mit signifikanter pulmonaler Hypertonie/Cor pulmonale
- unabhängiger Risikomarker6
- Bei unklarer Diagnose; kann bei starkem klinischem Verdacht entfallen, dann gleich Überweisung zur Echokardiografie.
- Blutbild
- Leberwerte, (GOT, GPT, Bilirubin); evtl. Serologie Hepatitis B und Hepatitis C bei V. a. PAH
- TSH
- Evtl. HIV-Serologie bei V. a. PAH (insbesondere bei erhöhtem Risiko für STD = Sexually Transmitted Disease)
- Evtl. ANA bei V. a. PAH
- Evtl. Thrombophilie-Screening bei Patient*innen mit CTEPH
Diagnostik bei Spezialist*innen
Rö-Thorax
- Erweiterung der Pulmonalarterien, verminderte Gefäßzeichnung in der Peripherie
- Lungenemphysem
- Lungenstauung bei Linksherzinsuffizienz
Echokardiografie
- Mit Abstand wichtigstes Bildgebungsverfahren zur Diagnostik von pulmonaler Hypertonie/Cor pulmonale
- daneben auch Erfassung von Erkrankungen des linken Ventrikels und der Klappen sowie von kongenitalen Vitien
- 2D-Echokardiografie
- Größe des rechten Ventrikels (RV)
- Dicke der RV-Wand (Hypertrophie?)
- RV-Funktion
- Abflachung des Septums als Zeichen der Rechtsherzbelastung
- Größe des rechten Vorhofs
- Diameter der rechten Pulmonalarterie
- V. cava (Diameter, Atemvariabilität)
- Farb-Doppler-Echokardiografie
- Trikuspidalklappeninsuffizienz
- Pulmonalklappeninsuffizienz
- Doppler-Echokardiografie
- Bestimmung der max. Flussgeschwindigkeit der Trikuspidalklappeninsuffizienz und daraus Abschätzung des systolischen Pulmonalarteriendrucks
- echokardiografische Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer pulmonalen Hypertonie bei symptomatischen Patient*innen mit Verdacht auf pulmonale Hypertonie:
- max. Geschwindigkeit Trikuspidalklappeninsuffizienz ≤ 2,8 m/s: niedrige Wahrscheinlichkeit
- max. Geschwindigkeit Trikuspidalklappeninsuffizienz 2,9–3,4 m/s: intermediäre Wahrscheinlichkeit
- max. Geschwindigkeit Trikuspidalklappeninsuffizienz > 3,4 m/s: hohe Wahrscheinlichkeit.
Magnetresonanztomografie (MRT)
- Alternative zum Echo bei unzureichenden Schallbedingungen zur Beurteilung des rechten (und linken) Ventrikels
Computertomografie (CT)
- HR-CT mit Kontrastmittel zur Diagnostik von:
- parenchymatöser Lungenerkrankung
- chronisch thrombembolischer Lungenerkrankung.
Ventilations-/Perfusionsszintigrafie der Lunge
- Nachweis einer chronisch thrombembolischen Lungenerkrankung
Lungenfunktionstest
- Nachweis einer obstruktiven oder restriktiven Lungenerkrankung
- Nachweis einer pulmonalen Diffusionsstörung
Spiroergometrie
- Wichtige Methode vor allem bei V. a. CTEPH, wenn andere nichtinvasive Methoden (Echokardiografie) keinen eindeutigen Hinweis auf pulmonale Hypertonie liefern.
- Teil der Risikostratifizierung bei pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1)
Blutgasanalyse (BGA)
- Erfassung einer Hypoxämie
- Entscheidung über Sauerstofftherapie
Rechtsherzkatheteruntersuchung
- Die Rechtsherzkatheteruntersuchung ist der „Goldstandard“ für den definitiven Nachweis einer pulmonalen Hypertonie.
- Bestimmung von:
- pulmonalarteriellem Druck (systolisch, diastolisch, mittlerer)
- pulmonalarteriellem Widerstand
- Herzminutenvolumen
- rechtsventrikulärem Druck (systolisch, diastolisch)
- zentralem Venendruck (ZVD).
- Evtl. Vasoreagibilitätstest bei pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1), keine Indikation bei den anderen Gruppen!
- Wird echokardiografisch eine pulmonale Hypertonie nachgewiesen, und es handelt sich um Gruppe 2 (Linksherzerkrankung) oder Gruppe 3 (Lungenerkrankung), ist eine Rechtsherzkatheteruntersuchung im Allgemeinen nicht notwendig! (siehe auch Leitlinienkasten unten)
Invasive Pulmonalisangiografie
- Im Rahmen der initialen Diagnostik heutzutage nicht notwendig
- Vor evtl. geplanter pulmonaler Endarterektomie
6-Minuten-Gehtest
- Risikostratifizierung und Verlaufskontrolle bei nachgewiesener pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1)
Diagnostischer Algorithmus
- Klinisch V. a. pulmonale Hypertonie (PH) sowie echokardiografischer Befund vereinbar mit PH
- Zur Detektion einer PH der Gruppe 2 (Linksherzerkrankung) oder Gruppe 3 (Lungenerkrankung)
- Anamnese
- klinische Befunde
- EKG
- Rö-Thorax
- Lungenfunktionstest
- HR-CT der Lunge
- Bei bestätigter Linksherz- oder Lungenerkrankung spezifische Behandlung der Grunderkrankung
- Bei schwerer PH und/oder RV-Dysfunktion Überweisung an Expertenzentrum zur Abklärung weiterer möglicher Ursachen für PH
- Falls keine Linksherz- oder Lungenerkrankung: Ventilations-/Perfusionsszintigrafie zur Differenzierung zwischen CTEPH (Gruppe 4) und PAH (Gruppe 1)
-
- bei mehreren segmentalen Perfusionsdefekten CTEPH (Gruppe 4) wahrscheinlich, dann ergänzend:
- CT-Pulmonalisangiografie
- Rechtsherzkatheter
- evtl. invasive Pulmonalisangiografie.
- Falls keine Perfusionsdefekte, kann PAH (Gruppe 1) vermutet werden.
- insbesondere bei Patient*innen mit assoziierten Erkrankungen/Risikofaktoren: Familienanamnese, Bindegewebserkrankung, HIV, portale Hypertonie, Drogen/Toxine
- Durchführung von Rechtsherzkatheter und spezifischen Tests (Hämatologie, Biochemie, Immunologie, Serologie, Sonografie und Genetik)
- bei mehreren segmentalen Perfusionsdefekten CTEPH (Gruppe 4) wahrscheinlich, dann ergänzend:
Checkliste zur Überweisung
Cor pulmonale
- Zweck der Überweisung
- Bestätigende Diagnostik? Therapie?
- Anamnese
- Klinische Untersuchung
- reduzierter Allgemeinzustand
- Tachypnoe
- Halsvenenstauung, periphere Ödeme
- auskultatorisch 3. HT, Trikuspidalklappeninsuffizienz, Pulmonalklappeninsuffizienz
- Ergänzende Untersuchungen
- EKG: Sinustachykardie, evtl. Vorhofflimmern, Rechtsbelastungszeichen
- Rö-Thorax
- Labor: Hb, NT-proBNP, Leberwerte, TSH; evtl. HIV/Hepatitis B und C/ANA/ Thrombophilie-Screening
- Diagnostik bei Spezialist*innen
- evtl. Ergebnisse von Echokardiografie, CT, Szintigrafie, Spirometrie, Spiroergometrie, Rechtsherzkatheter, Labor inkl. BGA
Therapie
Therapieziele
- Prognose verbessern.
- Funktionellen Status (WHO I–IV) verbessern und stabilisieren.
- Symptome lindern.
- Komplikationen vermeiden.
Allgemeines zur Therapie
Allgemeine supportive medikamentöse Therapie bei Cor pulmonale mit Rechtsherzinsuffizienz
- Diuretika
- Digoxin
- zur Behandlung atrialer Tachyarrhythmien
- Eisen
- Anämie oder Eisenmangel ohne Anämie sollten ausgeglichen werden.
- Sauerstofftherapie
- Ambulante O2-Therapie erwägen bei pO2 < 60 mmHg.6,
Weitere Maßnahmen
- Impfungen
- Impfungen gegen Influenza und Pneumokokken sinnvoll8
- Orale Antikoagulation (OAK)
- keine allgemeine Empfehlung zur OAK
- im Allgemeinen nur bei Patient*innen mit CTEPH oder Begleiterkrankungen mit Indikation zur OAK
- Rehabilitation: spezifische Maßnahmen und Physiotherapie sinnvoll zur Verbesserung von der
- körperlichen Belastbarkeit
- Herzfunktion
- Lebensqualität.
Schwangerschaft
- Erhöhtes Risiko für Komplikationen in der Schwangerschaft bei Patientinnen mit pulmonaler Hypertonie und insbesondere pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1)8
- Aktuelle Leitlinien raten von Schwangerschaft bei Patientinnen mit pulmonalarterieller Hypertonie ab.6
Spezielle Therapie bei verschiedenen Untergruppen mit pulmonaler Hypertonie
- Zur speziellen Therapie siehe auch den Artikel Pulmonale Hypertonie.
- Zu beachten ist, dass eine gezielte drucksenkende Therapie nicht bei allen Patient*innen mit pulmonaler Hypertonie in Betracht kommt, sondern nur bei Personen mit pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1) und chronisch thrombembolischer pulmonaler Hypertonie (CTEPH, Gruppe 4).
- Auch ein unkritischer Einsatz von Kalziumantagonisten ohne eindeutige Indikationsstellung ist zu vermeiden, da u. U. eine Verschlechterung bis hin zu letalen Folgen eintreten können.
- Die Grundregeln der Behandlung der pulmonalen Hypertonie von Patient*innen mit Linksherzerkrankung (Gruppe 2) und Lungenerkrankung (Gruppe 3) sind fast identisch.5
- Bei den Patient*innen mit pulmonaler Hypertonie der Gruppen 2 (Linksherzerkrankung), 3 (Lungenerkrankungen und/oder Hypoxie) und 5 (Multifaktoriell) steht die Behandlung der Grunderkrankung(en) im Vordergrund, ggf. ergänzt durch supportive Medikamente und Maßnahmen (s. o.).
Pulmonalarterielle Hypertonie (Gruppe I)6
- Hochdosierte Kalziumantagonisten bei Patient*innen, die auf einen Vasoreagibilitätstest im Rahmen der Rechtsherzkatheteruntersuchung ansprechen.
- Ohne Vasoreagibilitätstest keine Verabreichung hochdosierter Ca-Antagonisten!
- Bei Non-Respondern im Vasoreagibilitätstest oder unzureichendem Ansprechen auf Ca-Antagonisten drucksenkende Therapie mit einem Medikament der folgenden Substanzklassen:
- Endothelinrezeptorantagonisten
- Ambrisentan
- Bosentan
- Macitentan
- Phosphodiesterase-5-Hemmer
- Sildenafil
- Tadalafil
- Vardenafil
- Guanylatzyklasestimulatoren
- Riociguat
- Prostanoide stehen i. v., i. c. oder zur Inhalation zur Verfügung.
- Endothelinrezeptorantagonisten
- Initiale oder sequenzielle Kombinationstherapie mit Medikamenten der verschiedenen Substanzklassen möglich
- Keine eindeutigen Daten zur oralen Antikoagulation, nur niedriger Empfehlungsgrad (IIb/C)6
- Lungentransplantation als Ultima Ratio
Chronische thrombembolische pulmonale Hypertonie CTEPH (Gruppe 4)6
- Dauerhafte orale Antikoagulation
- Pulmonale Endarterektomie (PEA)9 nach Beurteilung durch ein Expertenteam von:
- Operabilität
- Nutzen-/Risikoverhältnis.
- Heutzutage sind 50–70 % der Patient*innen mit CTEPH operabel.5
- Medikamentöse drucksenkende Therapie mit Riociguat bei Persistenz nach PEA oder bei inoperablen Patient*innen
- Ballonangioplastie als neue Therapieoption (vor allem für subsegmentale Gefäßbereiche), aber noch keine Langzeitdaten10
- Screening auf CTEPH bei asymptomatischen Patient*innen nach Lungenembolie wird nicht empfohlen.
Pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankungen (Gruppe 2)6
- Therapie beruht auf optimaler Behandlung der Grunderkrankung
- Vasoreagibilitätstestung in dieser Gruppe nicht indiziert! (Ausnahme vor Herztransplantation)
- Spezifische drucksenkende Therapie in dieser Gruppe nicht indiziert!
- Dies gilt sowohl für systolische als auch diastolische Herzinsuffizienz.11
Pulmonale Hypertonie bei Lungenerkrankungen/Hypoxie (Gruppe 3)6
- Therapie beruht auf optimaler Behandlung der Grunderkrankung
- Sauerstoff-Langzeittherapie bei Hypoxämie
- Rechtsherzkatheteruntersuchung im Allgemeinen nicht indiziert! (Ausnahme bei V. a. auf zusätzlich bestehende PAH oder CTEPH oder vor Lungentransplantation)
- Spezifische drucksenkende Therapie in dieser Gruppe nicht indiziert!
Empfehlungen für Patient*innen
- Nikotinkarenz, unabhängig von der Grunderkrankung
- Reduktion des Übergewichts
- Adipositas beeinträchtigt die Atemarbeit.
- Potenzielle Infektionsquellen meiden.
Verlauf, Komplikationen und Prognose
Komplikationen
- Progredientes Rechtsherzversagen
- Kardiogener Schock
Verlauf und Prognose
- Generell schlechte Prognose von Patient*innen mit schwerer pulmonaler Hypertonie
- Bei Patient*innen mit pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1) kann die Prognose durch eine Risikostratifizierung eingeschätzt werden.
- anhand der 1-Jahres-Mortalität Einteilung in 3 Gruppen:
- niedriges Risiko: Mortalität < 5 %
- mittleres Risiko: Mortalität 5–10 %
- hohes Risiko: Mortalität > 10 %.
- Risikostratifizierung durch Bestimmung folgender Parameter:
- klinische Zeichen des Rechtherzversagens
- Progression der Symptome
- Synkope
- funktionelle Klasse nach WHO
- 6-Minuten-Gehtest
- Spiroergometrie
- NT-proBNP
- Bildgebung (Echokardiografie, MRT)
- Hämodynamik (Rechtsherzkatheter).
- anhand der 1-Jahres-Mortalität Einteilung in 3 Gruppen:
- Bei gegebener Indikation vermindert Langzeit-Sauerstofftherapie die Progression zu Rechtsherzversagen und bessert die Prognose.1
Verlaufskontrolle
- Engmaschige Verlaufskontrollen erforderlich:
- alle 3–12 Monate
- bei klinischer Verschlechterung
- zur Patienteninformation.
Patienteninformationen
Patienteninformationen in Deximed
Illustrationen
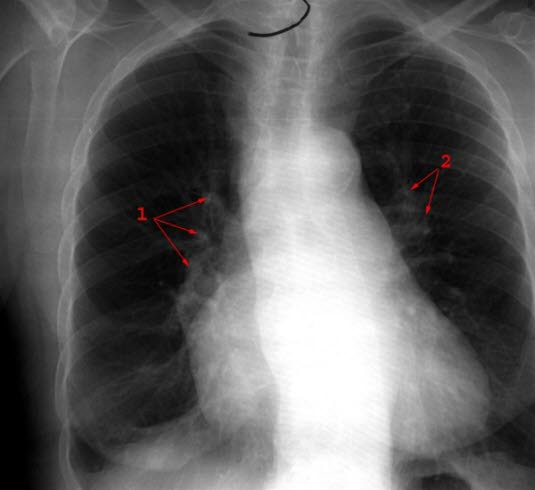
Cor pulmonale - frontal

Cor pulmonale - seitlich
Quellen
Leitlinien
- European Society of Cardiology. Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension, Stand 2015. www.escardio.org
Literatur
- Weitzenblum E. Chronic Cor pulmonale. Heart 2003; 89: 225–230. pmid:1767533 PubMed
- Leong D. Cor Pulmonale Overview of Cor Pulmonale Management. Medscape, updated Dec 15, 2017. Zugriff 11.03.18. emedicine.medscape.com
- Hoeper M, Bogaard H, Condliffe R, et al. Definitions and Diagnosis of Pulmonary Hypertension. J Am Coll Cardiol 2013; 62: D42-50. doi:10.1016/j.jacc.2013.10.032 DOI
- Hoeper M, Humbert M, Souza R, et al. A global view of pulmonary hypertension. Lancet Respir Med 2016; 4: 306-322. doi:10.1016/S2213-2600(15)00543-3 DOI
- Hoeper M, Ghofrani H, Grünig E, et al. Pulmonary hypertension. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 73-84. doi:10.3238/arztebl.2016.0073 DOI
- Galie N, Humbert M, Vachiery J, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J 2016; 37: 67-119. doi:10.1093/eurheartj/ehv317 DOI
- Simonneau G, Gatzoulis MA, Adatia I, et al. Updated clinical classification of pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol 2013; 62:D34. PubMed
- Dunlap B, Weyer G. Pulmonary Hypertension: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician 2016; 94: 463-469. www.aafp.org
- Moser KM, Auger WR, Fedullo PF. Chronic majorvessel thromboembolic pulmonary hypertension. Circulation 1990; 81: 1735-43. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Olsson K, Meyer B, Hinrichs J, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Dtsch Arztebl Int 2014; 111: 856-862. doi:10.3238/arztebl.2014.0856 DOI
- Rosenkranz S, Lang I, Blindt R, et al. Pulmonary hypertension associated with left heart disease: recommendations of the Cologne Consensus Conference 2016. Dtsch med Wochenschr 2016; 141: S48-S56. doi:10.1055/s-0042-114522 DOI
Autor*innen
- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.