Allgemeine Informationen
Definition
- Ziel der Therapie mit einem Schrittmacher (SM) ist die Normalisierung eines zu langsamen Herzschlags (Bradykardie).
- Therapiebedürftigkeit besteht beim Auftreten von durch die Bradykardie bedingten klinisch relevanten Symptomen wie:1
- Die drei großen Indikationsblöcke zur Schrittmachertherapie sind:
- Sinusknotenerkrankungen (Sick-Sinus-Syndrom = SSS)
- höhergradige AV-Blockierungen
- bradykardes Vorhofflimmern
Historisches
- 1958 erste Implantation eines Herzschrittmachers bei einem Patienten mit AV-Block durch Virusmyokarditis
- Transistoren und Batterien wurden in eine Schuhcremedose eingebaut, die mit Epoxidharz ausgegossen wurde.
- Erfolgreiche Behandlung mit Implantation von insgesamt 26 Schrittmachern bis zum Tod des Patienten 2002
Häufigkeit
- Indikationen zur Schrittmachertherapie
- AV-Block: ca. 44 %
- Sinusknotenerkrankung: ca. 36 %
- bradykardes Vorhofflimmern: ca. 14 %
- Verwendete Schrittmachersysteme
- Zweikammer: ca. 70 %
- Einkammer, ventrikulär: ca. 28 %
- Einkammer, atrial: ca. 1 %
- biventrikulär: ca. 1 %
Ätiologie von Bradykardien
Intrinsische Ursachen2
- Altersbedingte Degeneration
- Ischämische Herzerkrankung
- Infiltrative Erkrankungen: Sarkoidose, Amyloidose, Hämochromatose
- Autoimmunerkrankungen: systemischer Lupus erythematodes, rheumatoide Arthritis, Sklerodermie
- Angeborene Sinusknoten- und AV-Erkrankungen
- Infektionen: Myokarditis, Endokarditis, Borreliose, Chagas-Krankheit, Diphtherie, Typhus
- Chirurgisches oder katheterinterventionelles Trauma: Aortenklappenersatz, Herztransplantation, geplanter oder ungeplanter AV-Block im Rahmen von Ablationen
- Seltene genetische Erkrankungen: z. B. myotone Dystrophie, Mitochondrienerkrankungen
Extrinsische Ursachen2
- Körperliches Training
- Vagale Stimulation: vasovagal, Miktion, Husten etc.
- Medikamente
- Drogen
- Elektrolytstörungen, z. B. Hyperkaliämie
- Endokrinologische Störungen, z. B. Hypothyreose
- Neurologische Störungen mit erhöhtem intrazerebralen Druck
- Obstruktive Schlafapnoe
Pathophysiologie
- Entscheidender pathophysiologischer Mechanismus ist die Abnahme des Herzminutenvolumens durch die Bradykardie.2
- Solange das Schlagvolumen kompensatorisch erhöht werden kann, bleiben die Patienten asymptomatisch.2
- Bei einer gleichzeitigen LV-Dysfunktion ist diese Kompensation nur gering oder gar nicht möglich.
- Bei AV-Blockierungen kann durch das gestörte Zusammenspiel von Vorhof und Ventrikel zusätzlich die diastolische Füllung gestört werden.
- Bradykardien können abhängig von der zugrunde liegenden Störung permanent oder intermittierend auftreten.
- Folge des verminderten kardialen Auswurfs ist eine verschlechterte Organperfusion, wobei vor allem die zerebrale Minderperfusion zur Symptomatik beiträgt.
Prädisponierende Faktoren
- Höheres Alter
- Strukturelle, v. a. ischämische Herzerkrankungen
ICD-10
Relevante Diagnosen
- I44 Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock
- I45 Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen
- I46 Herzstillstand
- I47 Paroxysmale Tachykardie
- I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern
- I49 Sonstige kardiale Arrhythmien
Diagnostik
- Patienten mit Herzrhythmusstörungen stellen eine besondere Herausforderung für die Hausärzte dar, weil die Symptome zum Zeitpunkt der Vorstellung oder bei der Untersuchung häufig schon nicht mehr nachweisbar sind.
Diagnostische Kriterien
- Es existiert keine definierte Herzfrequenz, bei deren Unterschreitung ein Herzschrittmacher indiziert ist.2
- Entscheidend ist die Korrelation zwischen Symptomatik und Bradykardie.2
Dokumentation der Bradykardie
- Es wird unterschieden zwischen:
- persistierender Bradykardie
- intermittierender Bradykardie
- mit EKG-Nachweis
- vermutet (ohne EKG-Nachweis).
- Die Diagnose der persistierenden Bradykardie erfolgt durch Ruhe-EKG (siehe auch Checkliste EKG)
- Diagnose der intermittierenden Bradykardie durch Ruhe-EKG oder längerdauernde EKG-Aufzeichnungen (LZ-EKG oder Loop Recorder)
- Bei einer vermuteten, aber nicht dokumentierten Bradykardie im Einzelfall Provokationstests (Kipptisch, Karotissinusmassage) oder elektrophysiologische Untersuchung
Störungen der Erregungsbildung und -leitung als Ursache für Bradykardie und assoziierte Symptome
- Sinusknotenerkrankung (Sick-Sinus-Syndrom)
- Sinusbradykardie
- sinuatrialer Block (SA-Block)
- Sinusarrest
- AV-Block
- AV-Block I
- AV-Block II
- AV-Block III
- Vorhofflimmern mit langsamer Kammerfrequenz
Symptomatik
- Symptome bei akuter Abnahme der Herzfrequenz (intermittierende Bradykardien)
- Symptome bei chronischer Hypoperfusion (persistierende Bradykardie)
- kognitive Störungen
- Reizbarkeit
- Schwindel
- Herzinsuffizienzzeichen
- Leistungsminderung
- Belastungsdyspnoe
- rasche Ermüdbarkeit
Untersuchungen in der Hausarztpraxis
EKG
- Ruhe-EKG
- LZ-EKG
Labor
Diagnostik beim Spezialisten
- Externer Event Recorder
- Implantierbarer Event Recorder
- Belastungs-EKG bei belastungsinduzierten Synkopen
- Kipptischuntersuchung
- Elektrophysiologische Untersuchung
Leitlinie: Empfohlenes EKG-Monitoring abhängig von der Symptomfrequenz2
- Tägliche Symptome: 24-Stunden-EKG, ggf. Telemetrie bei Klinikaufenthalt
- Symptome alle 2–3 Tage: 48-72-Stunden-EKG, ggf. Telemetrie bei Klinikaufenthalt
- Symptome jede Woche: 120-Stunden-EKG, externer Event Recorder
- Symptome jeden Monat: externer Event Recorder
- Symptome seltener als 1 x pro Monat: implantierbarer Event Recorder
Therapie
Therapieziel
- Symptomatische Bradykardien verhindern.
Allgemeines zur Therapie
Persistierende Bradykardie
- Bei persistierender Sinusbradykardie (einschließlich chronotroper Inkompetenz) und klarem Zusammenhang mit Symptomatik soll ein Schrittmacher implantiert werden.
- Bei nur vermutetem Zusammenhang soll die Indikation sehr kritisch gestellt werden, im Einzelfall (vor allem bei älteren, multimorbiden Patienten mit schwieriger Zuordnung) ist eine Implantation aber möglich (IIb-Indikation).
- Bei nicht verzichtbarer bradykardisierender Medikation (z. B. Betablocker nach Infarkt/bei Herzinsuffizienz) sollte diese beibehalten und ein Schrittmacher implantiert werden.
- Bei höhergradigem AV-Block (AV-Block 3. Grades oder AV-Block 2. Grades Mobitz) besteht eine Schrittmacherindikation sowohl bei vorhandener als auch bei fehlender Symptomatik.
- bei fehlender Symptomatik prognostische Indikation zur Vermeidung eines plötzlichen Herztods
- Bei AV-Block 2. Grades Wenckebach ergibt sich die Indikation nur bei eindeutiger Symptomatik.
Intermittierende Bradykardie
- Bei einer eindeutigen Korrelation zwischen Symptomen und EKG-Befund besteht die Indikation zur Schrittmacherimplantation.2
- Intermittierende Pausen können verursacht sein durch:
- Intermittierende Störung der Sinusknotenfunktion: Hierzu gehört auch die Pause nach Beendigung von Vorhofflimmern vor Einspringen des Sinusknotens.
- intermittierender AV-Block 2. oder 3. Grades, einschließlich Vorhofflimmern mit intermittierend bradykarder Überleitung
- Auch bei asymptomatischen Patienten sollte bei dokumentierten Pausen > 6 s eine Schrittmacherimplantation erwogen werden.
- Zu den primär nicht dokumentierten, aber vermuteten Bradykardien gehören:
- Reflexsynkopen (neurokardiale Synkope, Karotissinussyndrom)
- unklare Synkopen bei Schenkelblock.
- Die Evidenz für eine SM-Implantation bei neurokardialer Synkope ist nur schwach, kann im Einzelfall nach kardioinhibitorischer Reaktion in der Kipptischuntersuchung erwogen werden.
- Die Diagnose Karotissinussyndrom sollte nur bei anamnestisch typischer Karotisreizung (z. B. Krawatte binden, Kopfdrehung) vor Synkope gestellt werden, die Auslösung einer Asystolie durch Karotismassage ist besonders im Alter unspezifisch.
- Bei unklarer Synkope mit vorbestehendem Schenkelblock sollte primär eine Dokumentation der Ursache angestebt werden, z. B. durch implantierbaren Event Recorder.
- Im Einzelfall kann eine elektrophysiologische Untersuchung hilfreich sein.
- Keine SM-Indikation liegt vor bei:
- asymptomatischen oder durch reversible Ursachen ausgelösten Sinusknotenfunktionsstörungen
- AV-Block durch reversible, vermeidbare Ursachen
- asymptomatischem Schenkelblock.
Leitlinie: Indikation zur SM-Implantation2
Persistierende Bradykardie
- Sick-Sinus-Syndrom
- mit Symptomen, die klar einer Bradykardie zugeordnet werden können
- mit Symptomen, die vermutlich einer Bradykardie zugeordnet werden können
- AV-Block
- AV-Block 3. Grades oder AV-Block 2. Grades Mobitz unabhängig von der Symptomatik
- symptomatischer AV-Block 2. Grades Typ Wenckebach und AV-Block 2. Grades mit intra- oder infrahisärer Lokalisation
- persistierende Symptome i. S. e. Schrittmachersyndroms bei AV-Block 1. Grades mit PQ > 300 ms
Intermittierende Bradykardie
- Sick-Sinus-Syndrom inkl. Brady-Tachy-Typ mit symptomatischer Bradykardie infolge Sinusarrest oder SA-Block
- Intrinsischer intermittierender oder paroxysmaler AV-Block 2. oder 3. Grades (inkl. Vorhofflimmern mit intermittierender bradykarder Überleitung
- Rezidivierende neurokardiale Synkope ohne Prodromi mit dokumentierten, symptomatischen Pausen durch Sinusarrest und/oder AV-Block bei Patienten ≥ 40 Jahre
- Asymptomatische Pausen (Sinusarrest oder AV-Block) > 6 s bei Patienten mit Synkope
Wahl des Schrittmachermodus
- Bei der Auswahl des Schrittmachersystems müssen zunächst folgende Fragen gestellt werden:
- Liegt eine Sinusknotenfunktionsstörung vor?
- Liegt eine AV-Überleitungsstörung vor?
- Besteht Vorhofflimmern?
- Liegt eine Kombination aus diesen Störungen vor?
- Die wichtigsten Schrittmachermodi sind:
- DDDR (Stimulation in Vorhof und Kammer)
- VVIR (Stimulation nur in der Kammer)
- AAIR (Stimulation nur im Vorhof).
- Benennung des Schrittmachermodus
- Buchstabe = Stimulationsort (V = Ventrikel, A = Vorhof, D = Ventrikel und Vorhof)
- Buchstabe = Detektionsort (V = Ventrikel, A = Vorhof, D = Ventrikel und Vorhof)
- Buchstabe = Betriebsmodus (I = inhibiert, D = getriggert und inhibiert)
- Buchstabe = Frequenzanpassung (R = Rate)
- DDD-Systeme sind überwiegend 1. Wahl sowohl bei Sinusknotenfunktionsstörungen als auch bei AV-Überleitungsstörungen
- Löst im Vergleich zur Einkammerstimulation seltener Vorhofflimmern aus.
- Außerdem tritt durch die abgestimmte Erregung von Vorhof und Kammer seltener ein unangenehmes Schrittmachersyndrom auf, dadurch erhöht sich die Lebensqualität.
- Eine Ausnahme ist Vorhofflimmern mit langsamer Kammerfrequenz, hier sind VVI-Schrittmacher 1. Wahl.
- Eine Vorhofstimulation wäre hier sinnlos (bei Vorhofflimmern keine mechanische Kontraktion durch Stimulation induzierbar), sodass auf die Vorhofelektrode verzichtet werden kann.
- AAI-Schrittmacher sind bei primär reiner Sinusknotenerkrankung möglich.
- Sie sind allerdings nur 2. Wahl, da 1–2 % der Patienten jährlich eine AV-Blockierung entwickeln mit Notwendigkeit zur Reintervention und Aufrüstung auf ein DDD-System.2
Leitlinie: Wahl des SM-Modus2
Persistierende Bradykardie
- Sick-Sinus-Syndrom
- Ein Zweikammer-Schrittmacher mit Erhalt der spontanen AV-Überleitung ist indiziert zur Reduktion des Risikos für Vorhofflimmern und Schlaganfall, zur Vermeidung eines Schrittmachersyndroms und zur Verbesserung der Lebensqualität.
- Eine Frequenzadaptation sollte bei Patienten mit chronotroper Inkompetenz aktiviert werden, insbesondere bei jungen und körperlich aktiven Patienten.
- AV-Block
- Bei Patienten im Sinusrhythmus sollte ein Zweikammer-Schrittmacher gegenüber einem ventrikulären Einkammer-Schrittmacher bevorzugt werden, um ein Schrittmachersyndrom zu verhindern und die Lebensqualität zu verbessern.
- Permanentes Vorhofflimmern mit AV-Block
- Ein ventrikulärer Einkammer-Schrittmacher mit Frequenzadaptation wird empfohlen.
Intermittierende Bradykardie
- Eine Aufrechterhaltung der spontanen AV-Überleitung wird empfohlen.
Implantation des Herzschrittmachers
- Die Implantation eines Herzschrittmachers erfolgt heutzutage häufig ambulant, alternativ im Rahmen eines kurzstationären Aufenthaltes.
- Durchführung des Eingriffs in Lokalanästhesie, evtl. mit Sedation
- Dauer des Eingriffs – Medianwerte 2012
- DDD-Schrittmacher: 52 min Implantationsdauer
- VVI-Schrittmacher: 37 min Implantationsdauer
Herzschrittmacher und MRT
- Früher galt ein Herzschrittmacher als absolute Kontraindikation für eine Magnetresonanztomografie (MRT).
- Dies ist ein relevantes Problem, da bis zu 75 % der Schrittmacherpatienten aufgrund von Begleiterkrankungen im weiteren Verlauf eine Indikation für eine MRT aufweisen.2
- Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass bei konventionellen Schrittmachern unter bestimmten Rahmenbedingungen MRT mit vertretbarem Risiko durchgeführt werden kann.
- Ist der Nutzen durch den Einsatz einer MRT höher als das potenzielle Risiko, kann daher eine Durchführung erwogen werden.
- Mittlerweile sind auch MRT-kompatible Schrittmachersysteme verfügbar und werden zunehmend implantiert.
- Bei modernen, MRT-fähigen Schrittmachern gilt die Durchführung (bis zu 1,5 Tesla) unter Beachtung der Herstellerangaben als sicher.
- Vor der Untersuchung muss Rücksprache mit einer Herzschrittmacherspezialistin/einem Herzschrittmacherspezialisten genommen werden, und der Schrittmacher muss vor der MRT umprogrammiert werden.
Verlauf, Komplikationen und Prognose
Verlauf und Prognose
- In einer retrospektive Analyse von Schrittmacherpatienten betrug insgesamt die 5-Jahre-Überlebensrate 66 %, die 20-Jahre-Überlebensrate 21 %.3
- Sick-Sinus-Syndrom: 5-Jahres-Überlebensrate 74 %, 20-Jahres-Überlebensrate 27 %
- AV-Block: 5-Jahres-Überlebensrate 62 %, 20-Jahres-Überlebensrate 19 %
- Vorhofflimmern: 5-Jahres-Überlebensrate 59 %, 20-Jahres-Überlebensrate 15 %
- Schrittmacherpatienten ohne relevante Komorbiditäten haben eine ähnliche Lebenserwartung wie die Allgemeinbevölkerung.4
- Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern und nichtkardiale Komorbiditäten haben den größten Anteil an der Reduktion der Lebenserwartung bei Schrittmacherpatienten.4
Komplikationen
- Bei den derzeitigen Schrittmachersystemen und -techniken liegt die Komplikationsrate bei 1–6 %.5
- Perioperative Komplikationen
- Taschenhämatom
- Pneumothorax
- Hämatothorax
- Ventrikelperforation/Tamponade
- Komplikationen im weiteren Verlauf
- Sondendislokation
- mechanische Störungen der Sondenfunktion
- Infektionen (Tasche, Sonden, Herzklappen)
- Aggregatwechsel und Revisionsoperationen im Vergleich zur primären Implantation mit 2- bis 4-fach erhöhtem Infektionsrisiko6
- Störungen der Trikuspidalklappenfunktion
- venöse Thrombose
- Zwerchfellstimulation
- Narben- und Keloidbildung im Inzisionsbereich
- Bestimmte Komplikationen werden künftig möglicherweise durch neue System und Implantationstechniken vermieden werden können, z. B. durch sondenfreie Herzschrittmacher.
Nachsorge
- Zeitplan für Schrittmacherkontrollen
- 1. Kontrolle nach Implantation vor Entlassung: individuelle Programmierung
- 2. Kontrolle nach 4 Wochen: Messung aller Parameter, Wundkontrolle
- 3. Kontrolle nach 3-6 Monaten: Endeinstellung, Optimierung der Stimulationsparameter
- planmäßige Kontrollen alle 6–12 Monate: Messung aller Parameter
- kürzere Kontrollen alle 3 Monate oder kürzer: bei nahendem Austauschzeitpunkt
- außerplanmäßige Kontrollen: Eingriffe mit Elektrokauter, Defibrillation, MRT, kardiale Ereignisse
- Aufgaben der Schrittmacherkontrolle sind:
- Die Funktionsfähigkeit des Systems überprüfen.
- Komplikationen bzw. Fehlfunktionen erkennen und beheben.
- Die Laufzeit des Schrittmachers verlängern.
- Den optimalen Austauschzeitpunktes eines Systems festlegen.
- Die programmierbaren Parameter individuell optimieren.
- Die zur Verfügung stehenden Diagnostik- und Therapieoptionen anpassen.
- Über die erforderliche Aufrüstung eines Schrittmachersystems (Zweikammer-, CRT- System, Defibrillator) entscheiden.
Patienteninformationen
Patienteninformationen in Deximed
Illustrationen
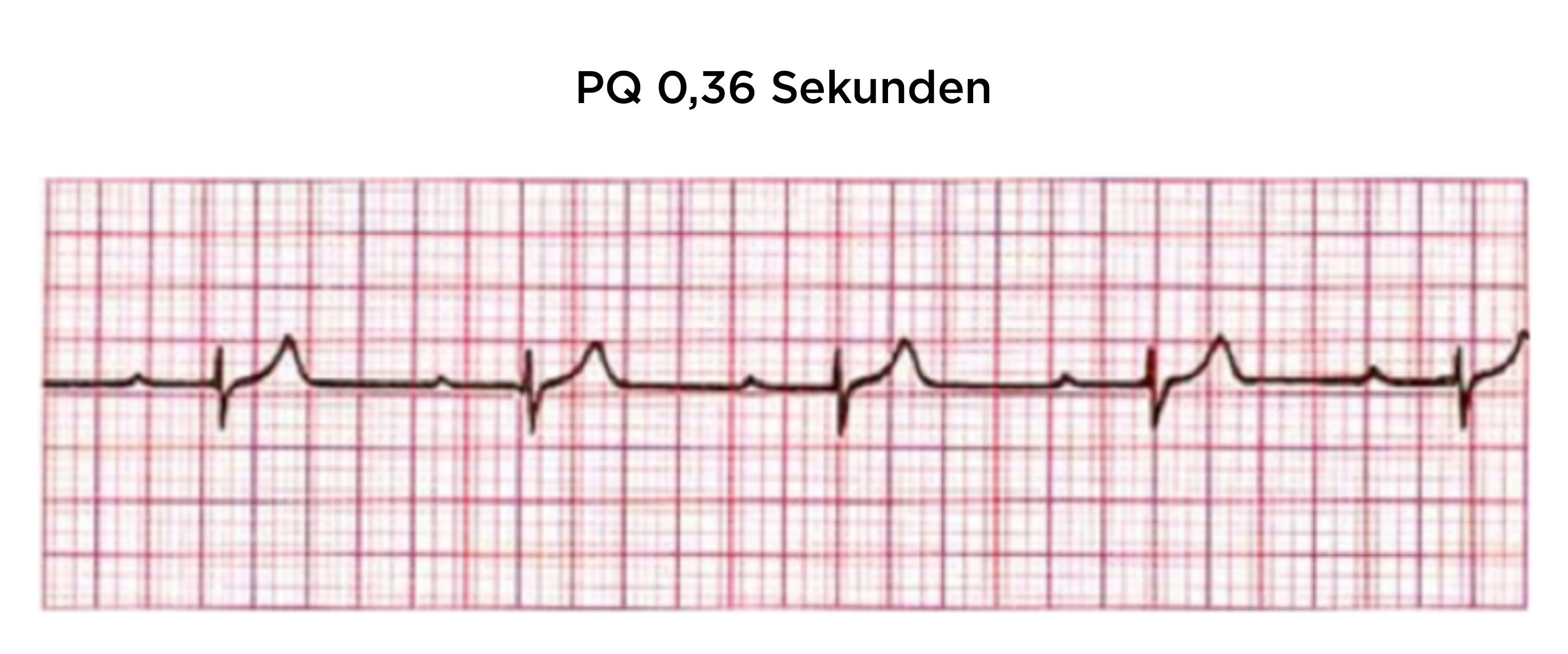
AV-Block 1. Grades
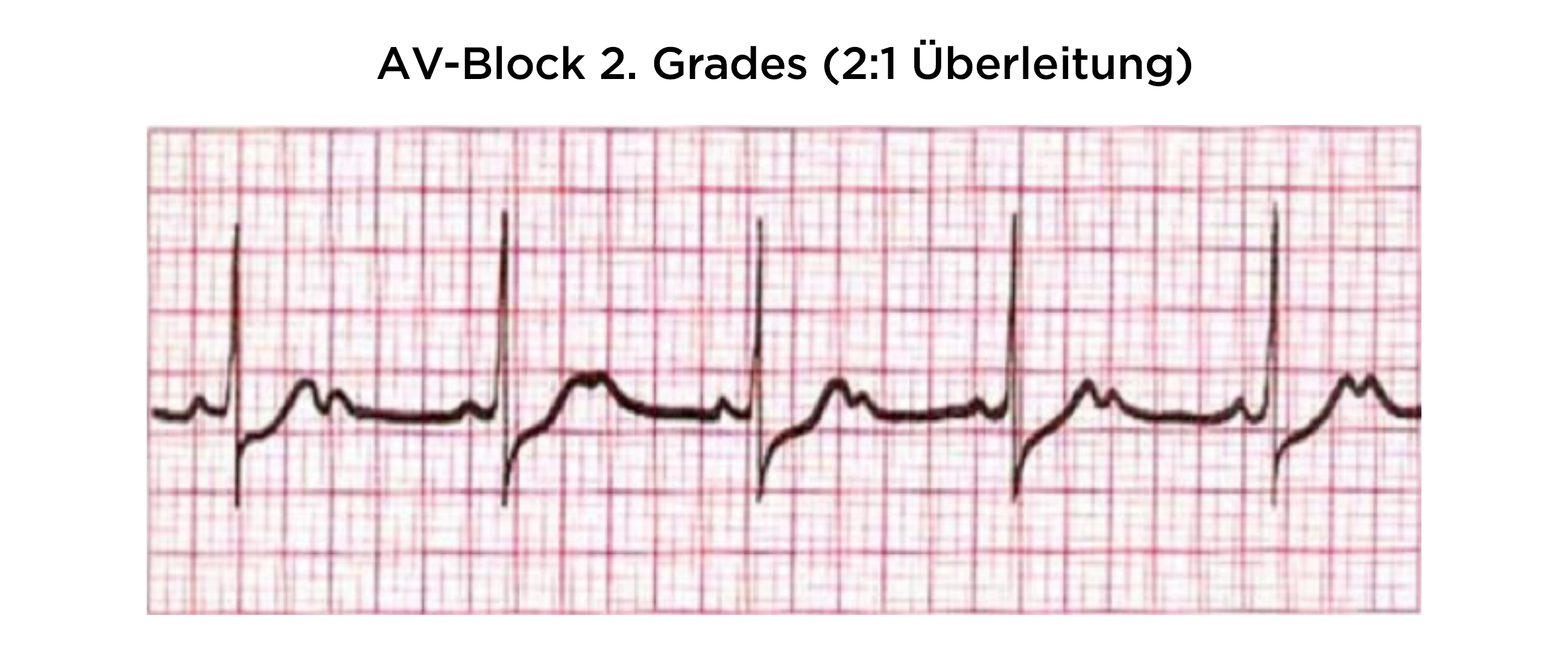
AV-Block 2. Grades
Quellen
Leitlinien
- European Society of Cardiology: Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Stand 2013. www.escardio.org
Literatur
- Trappe H, Gummert J. Current pacemaker and defibrillator therapy. Dt Arztebl Int 2011; 108: 372-80. doi:10.3238/arztebl.2011.0372 DOI
- 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Brignole A, Auricchio A, Baron-Esquivias G, et al. Eur Heart J 2013; 34: 2281–2329. doi:10.1093/eurheartj/eht150 DOI
- Brunner M, Olschewski M, Geibel A, Bode C, Zehender M. Long-term survival after pacemaker implantation. Prognostic importance of gender and baseline patient characteristics. Eur Heart J 2004; 25: 88-95. pmid:14683747 PubMed
- Bradshaw P, Stobie P, Knuiman M, et al. Life expectancy after implantation of a first cardiac permanent pacemaker (1995–2008): A population-based study. Int J Cardiol 2015; 190: 42-46. doi:10.1016/j.ijcard.2015.04.099 DOI
- Mulpuru S, Madhavan M, McLeod C, et al. Cardiac Pacemakers: Function,Troubleshooting, and Management. J Am Coll Cardiol 2017; 69: 189–210. doi:10.1016/j.jacc.2016.10.061 DOI
- Döring M, Richter S, Hindricks G. The diagnosis and treatment of pacemaker-associated infection. Dtsch Arztebl Int 2018; 115: 445–52. doi:10.3238/arztebl.2018.0445 DOI
Autoren
- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.