Zusammenfassung
- Definition:Eisenmangelbedingtes Absinken der Hämoglobinkonzentration unter den alters-/geschlechtsspezifischen Normwert.
- Häufigkeit:Eisenmangel bei ca. 10–15 %, Eisenmangelanämie bei ca. 5 % der Kinder und Jugendlichen.
- Symptome:Eisenmangel ist assoziiert mit zahlreichen unspezifischen Symptomen (Müdigkeit, Leistungsminderung, Kälteempfindlichkeit, kognitive Störungen u. a.). Bei Anämie Schwindel, Belastungsdyspnoe, Palpitationen.
- Befunde:Trophische Störungen (Haare, Haut, Zunge, Nägel); bei Anämie Blässe, Tachykardie, Herzgeräusch.
- Diagnostik:Labordiagnostische Bestimmung von Blutbild (Hb, MCV, Retikulozyten) und Eisenstatus (Ferritin, evtl. ergänzende Parameter wie Transferrinsättigung). CRP/BSG zum Ausschluss einer Entzündung mit Maskierung eines Speichereisenmangels.
- Therapie:Ernährungsberatung (vegetarische/vegane Ernährung zunehmend häufiger Risikofaktor für Eisenmangel), orale Substitution von Eisen. Intravenöse Substitution nur im begründeten Einzelfall.
Allgemeine Informationen
Definition
- Eisenmangel ist definiert als Verminderung des Gesamtkörpereisens.
- Anämie ist definiert durch die Verminderung der Hämoglobinkonzentration im Blut unterhalb der Altersnorm (siehe Tabelle Eisenmangelanämie, altersabhängige Normalbereiche).
- Charakteristisch für die Eisenmangelanämie ist eine hyporegeneratorische, mikrozytäre und hypochrome Anämie mit erheblicher Anisozytose infolge einer Verminderung der Verfügbarkeit von Eisen für die Erythropoese.
Häufigkeit
- Prävalenz
- Eisenmangel ist ein weltweit bei Kindern verbreiteter Nährstoffmangel, insbesondere in Entwicklungsländern.1
- Auch in Europa weisen ca. 10–15 % der Kinder einen Eisenmangel auf.
- Eisenmangelanämie bei ca. 5 % der Kinder und Jugendlichen
- Geschlecht
- Eisenmangelanämie in Deutschland bei 5,5 % der Mädchen und 4,8 % der Jungen
- Alter
- Neugeborene sind in den ersten Lebensmonaten meist nicht betroffen wegen in der Fetalzeit aufgebauter Reserven.2
- höchste Prävalenz in Altersgruppe von 1–2 Jahren
- zweiter Gipfel während des pubertären Wachstumsschubs, insbesondere bei Mädchen aufgrund der gleichzeitig durch Menstruation auftretenden Blutverluste2
Ätiologie und Pathogenese
Physiologie des Eisenstoffwechsels
- Der Eisengehalt des Körpers wird ausschließlich über die Aufnahme reguliert.
- Bedarfsadaptiert Resorption von ca. 5–10 % des mit der Nahrung aufgenommen Eisens
- bei Eisenmangel Anstieg auf bis 20–30 %
- Eisen liegt in tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln in ähnlicher Konzentration vor, allerdings in unterschiedlichen Verbindungen mit unterschiedlicher Bioverfügbarkeit.
- Der beste Eisenlieferant ist Fleisch, da Eisen hier zu 40–90 % als zweiwertiges Häm-Eisen (Fe2+) vorliegt, das über einen eigenen Transporter wesentlich effektiver aufgenommen werden kann.
- In pflanzlichen Produkten liegt dreiwertiges Eisen (Fe3+) vor, das um den Faktor 4 weniger bioverfügbar ist.
- Muss zunächst durch Enzym an luminaler Darmmembran zu Fe2+ reduziert werden.
- Die Resorption von zweiwertigem Eisen erfolgt im Duodenum und oberen Jejunum.
- Der Transport im Blut erfolgt durch Bindung an Transferrin.
- Unter physiologischen Bedingungen sind 16–45 % der Transferrinmoleküle im Plasma mit Eisen gesättigt, bei Eisenmangel ist der Anteil erniedrigt.
- Die Eisenspeicherung erfolgt durch wasserlöslichen Proteinkomplex Ferritin, dessen Serumkonzentration mit Eisenspeichern korreliert.
- 1 µg/l Ferritin entspricht dabei 10 mg Speichereisen.
- Eine zentrale Rolle bei der Regulation der Eisenaufnahme aus der Nahrung spielt das in der Leber gebildete Peptidhormon Hepcidin.
- Hepcidin kann Eisentransporter (DMT-1, Ferroportin 1) herunterregulieren.
- Produktion und Freisetzung von Hepcidin wird u. a. durch Transferrinrezeptoren beeinflusst.
- Bei Eisenmangelanämie wird die Hepcidinproduktion in der Leber vermindert, um die Eisenaufnahme im Darm zu steigern.
Ätiologie
- Grund für Eisenmangelanämie ist ein Missverhältnis zwischen Eisenaufnahme und -bedarf.
- entweder ungenügende Eisenzufuhr mit der Nahrung, oder gesteigerter Bedarf oder erhöhter Verlust des Eisens
- Bei Kindern und Jugendlichen ist in den meisten Fällen Fehlernährung ursächlich.
- Wachstumsbedingter Eisenbedarf ist im Verhältnis zum Eisenangebot in der Nahrung zu groß, insbesondere im Zeitraum vom 6.–24. Lebensmonat.
- Reifgeborene haben relativ hohen Hämoglobingehalt im Blut, der in den ersten 6 Monaten auch als Eisenquelle genutzt wird.
- Frühgeborene hingegen haben keine Eisenspeicher und damit postnatal hohen Bedarf mit hohem Risiko für Eisenmangel.
- Gefährdet sind zudem Säuglinge, die mit Milchersatzprodukten aus Kuhmilch ernährt werden, da Kuhmilch verglichen mit Muttermilch weniger Eisen enthält und durch hohen Phosphatgehalt schlechter resorbiert wird.
- Bei Adoleszenten können das rasche Wachstum mit Ausbildung eines größeren Blutvolumens und höherer Muskelmasse und das Einsetzen der Menarche die Eisenspeicher aufbrauchen.
- Wachstumsbedingter Eisenbedarf ist im Verhältnis zum Eisenangebot in der Nahrung zu groß, insbesondere im Zeitraum vom 6.–24. Lebensmonat.
- Bei ausreichendem alimentären Eisenangebot können einem Eisenmangel zugrunde liegen:
- verminderte duodenale Resorption (z. B. bei Zöliakie)
- chronischer Blutverlust (z. B. bei Menorrhagie)
- chronische entzündliche Erkrankung (z. B. chronisch entzündliche Darmerkrankung)
- genetisch bedingte eisenrefraktäre Eisenmangelanämie (selten).
Pathogenese
- Abhängig von Eisenstatus und hämatologischen Veränderungen können drei Phasen eines Eisenmangels abgegrenzt werden:2
- Stadium I (Speichereisenmangel)
- negative Eisenbilanz
- Speichereisenmangel
- hämatologisch keine Beeinträchtigung
- Stadium II (eisendefizitäre Erythropoese)
- Stadium III (Eisenmangelanämie)
- Hb unterhalb der Normgrenze
Prädisponierende Faktoren
- Risikofaktoren für Eisenmangel und Anämie
- vegetarische/vegane Ernährung
- Periodenblutung
- Migrationshintergrund
- niedriger sozialer Status
- mittel- und großstädtischer Lebensraum
- Adipositas
- Vollstillen > 6 Monate (nur für unter 3-Jährige nachweisbar)
- Frühgeburtlichkeit/Übertragung (nur für unter 3-Jährige nachweisbar)
- Zudem kann eine Eisenmangelanämie im Rahmen chronischer Erkrankungen entstehen wie:
- Zöliakie
- chronisch-entzündliche Darmerkrankungen.
ICPC-2
- B80 Eisenmangelanämie
ICD-10
- D50 Eisenmangelanämie
Diagnostik
Diagnostische Kriterien
- V. a. Eisenmangel durch klinische Symptome und Befunde
- Diagnosestellung durch dazu passende Pathologie des Blutbilds
- Siehe Tabelle Eisenmangelanämie, altersabhängige Normalbereiche.
- Diagnostischer Algorithmus:
- Abnahme von kleinem Blutbild, MCV, Ferritin und CRP
- klassisch bei Eisenmangelanämie: Hb, MCV und Ferritin erniedrigt
- Bei normwertigem/erhöhtem Ferritin Kontrolle von CRP, um entzündungsbedingte Erhöhung des Ferritins (Akut-Phase-Protein) auszuschließen.
- CRP normwertig: V. a. Thalassämie
- CRP erhöht: zusätzlich Bestimmung von löslichem Transferrinrezeptor (sTfR, „entzündungsunabhängiger“ Parameter); Erhöhung von sTfR bestätigt eine Eisenmangelanämie.
- Ein Therapieansprechen auf die orale Eisensubstitution ist der beste funktionelle Beweis für alimentären Eisenmangel.
Differenzialdiagnosen
- Andere häufige Ursachen für Anämien im Kleinkindesalter
- akute, rezidivierende und chronische Infektionen (Infektanämien)
- Thalassaemia minor
- chronische Krankheiten
- Differenzialdiagnosen mikrozytärer Anämien, u. a.:
- Hämoglobinopathien, insbesondere Thalassämien
- Bleiintoxikation
- Hypovitaminosen: Vitamin A, B6, C, D
- sideroblastische Anämien und hereditäre Störungen des Eisenmetabolismus.
Anamnese
- Symptome
- Unerklärte Müdigkeit ist das häufigste Symptom eines Eisenmangels.3
- weitere Störungen des Allgemeinbefindens (Leistungsminderung, Schlafunregelmäßigkeiten, Kopfschmerzen, Kälteempfindlichkeit)
- kognitive Beeinträchtigungen, schulische Leistungsschwäche
- Restless Legs
- Schwindel, Belastungsdyspnoe, Palpitationen
- Frühgeburtlichkeit
- Familienanamnese
- seltene genetisch determinierte Formen
- Thalassämie
- Ernährung
- vegetarisch oder vegan
- Bei Mädchen
- Menstruation bereits eingesetzt?
- Hypermenorrhö, Menorrhagie, Metrorrhagie
- Hinweise für chronische Erkrankungen, z. B. Zöliakie
- Dyspepsie, Stuhlunregelmäßigkeiten, Durchfälle
Klinische Untersuchung
- Blässe
- Trophische Störungen
- Haarausfall
- Mundwinkelrhagaden
- glatte atrophische Zunge
- Koilonychie (beim Kind seltene löffelförmige Deformität von Finger- und Zehnägeln bei schwerem chronischem Eisenmangel)
- Tachykardie, Herzgeräusch
- Im Extremfall Pica
- Essstörung, bei der widerliche oder ungenießbare Substanzen gegessen werden (selten als Folge von Eisenmangel).
Ergänzende Untersuchungen in der Hausarztpraxis
Erfassung einer Anämie bei Eisenmangel
- Rotes Blutbild
- Hb (Hämoglobin): Erniedrigter Wert zeigt die Anämie an.
- MCV, MCHC and MCH typischerweise bei Eisenmangelanämie erniedrigt3
- Cave: bei Kombination mit anderen Mängeln, z. B. an Folsäure oder Vitamin B12, können Werte auch normwertig sein. Bei erhöhtem MCV ist Eisenmangel unwahrscheinlich.
- RDW (Red Cell Distribution Width): Standardabweichung des MCV als Maß für die Anisozytose, bei Eisenmangelanämie erhöht3
- Retikulozyten: bei Eisenmangelanämie für das Ausmaß der Anämie inadäquat niedrig
Beurteilung des Eisenstatus
- Ferritin: bei Eisenmangel erniedrigt
- kostengünstig, frühester Marker eines Eisenmangels3
- korreliert bei sonst gesunden Menschen gut mit den Eisenspeichern
- bei systemischen Entzündungen als Akut-Phase-Protein erhöht mit möglicher Maskierung eines Eisenmangels
- Als alleiniger Parameter zur Beurteilung des Eisenstatus daher nur bedingt zuverlässig, eine Entzündung sollte ausgeschlossen sein (Klinik, BSG, CRP) bzw. weitere Parameter des Eisenstatus herangezogen werden.
- Transferrinsättigung: bei Eisenmangel erniedrigt
- Maß für die Eisenbeladung des zirkulierenden Transferrins, das Eisen aus den Speichern zum Knochenmark transportiert.
- Zeigt das zur Verfügung stehende Funktionseisens an und ist Parameter einer eisendefizitären Erythropoese.
- Schwächen der Transferrinsättigung: Kann bei Entzündungen trotz normaler Eisenspeicher erniedrigt sein, unterliegt zirkadianen Schwankungen.
- Löslicher Transferrin-Rezeptor: bei Eisenmangel erhöht
- Vorteil im Vergleich zu Ferritin und Transferrinsättigung ist die Unabhängigkeit der Werte von Entzündungen.
- allerdings teuer und nicht in allen Laboren verfügbar, Referenzwerte testabhängig3
- CRP/BSG
- zum Ausschluss einer systemischen Entzündung mit Anstieg des Ferritins (Akut-Phase-Protein) und damit möglicher Maskierung eines Eisenmangels
Therapie
Therapieziele
- Ausgleich einer Anämie
- Ausgleich eines Eisenmangels
Allgemeines zur Therapie
- Ggf. Behandlung einer Grunderkrankung, die für den Eisenmangel verantwortlich ist, z. B. Zöliakie.
- Eine Anämie ist auf jeden Fall behandlungsbedürftig.
- Ein symptomatischer Eisenmangel sollte auch bei noch normalen Hb-Werten behandelt werden.
- Eine sichere Zuordnung einer Symptomatik zu einem Eisenmangel ist allerdings häufig nicht möglich.
- Ein Therapieansprechen auf Eisensubstitution kann als funktioneller Nachweis eines symptomatischen Eisenmangels betrachtet werden.
- Komponenten der Therapie sind:
- Ernährungsberatung
- medikamentöse Eisensubstitution (im Allgemeinen oral, nur im begründeten Einzelfall i. v.).
Ernährungsberatung
- Grundsätzlich wird eine tägliche Eisenzufuhr über die Nahrung empfohlen bei:
- Kindern im Alter von 4 Monaten bis 7 Jahren: 8 mg
- Kindern im Alter von 7–10 Jahren: 10 mg
- Kindern und Jugendlichen von 10–19 Jahren
- Jungen: 12 mg; Mädchen: 15 mg.
- Bei Kindern und Jugendlichen sollte von einer streng vegetarischen oder veganen Ernährung abgeraten werden.
- Optimierung der Eisenzufuhr (insbesondere auch bei vegetarischer/veganer Ernährung)
- Gleichzeitige Aufnahme von Vitamin-C-haltigen Nahrungsmitteln verbessert die Eisenverfügbarkeit pflanzlicher Lebensmittel.
- Kaffee vermindert die Eisenresorption und sollte nicht direkt vor, während und nach eisenreichen Mahlzeiten getrunken werden.
- Informationen zum Eisengehalt von Nahrungsmitteln (zu berücksichtigen ist dabei die ca. 4-fach höhere Bioverfügbarkeit von Eisen aus tierischen Lebensmitteln)
- Auswahl des Eisengehalts einiger Nahrungsmittel (mg/100 g)
- tierisch
- Rindfleisch: 2,9
- Schweinefleisch: 2,5
- Putenfleisch 3,0
- Lachs: 0,7
- pflanzlich
- Linsen 6,9
- Erbsen 5,0
- Haferflocken: 4,6
- Roggenbrot: 3,3
- Reis (Vollkorn): 2,6
- Feldsalat: 1,9
Medikamentöse Therapie
Oral3
- Präparate der Wahl
- Eisen(II)-Sulfat
- Eisen(II)-Fumarat
- bei Unverträglichkeit von Eisen (II)–Präparaten alternativ Eisen (III)–hydroxid-Polymaltose
- Dosierung
- Eisen(II)-Präparat: 2–3 mg/kg tgl.
- Eisen(III)-Präparat: 3–5 mg/kg tgl.
- Art der Verabreichung
- konventionell in 1–2 Einzeldosen nüchtern bzw. eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen (nicht in Milch, Tee oder Kaffee)
- bei täglicher Gabe allerdings Resorptionsminderung durch Erhöhung der Hepcidin-Serumkonzentration möglich
- daher bei leichtem bis mäßigem Eisenmangel Gabe an alternierenden Tagen empfohlen
- Dauer der Substitution
- Nebenwirkungen
- häufig gastrointestinale Beschwerden bei oraler Therapie
- bei anhaltenden Beschwerden > 1 Woche ggf. Versuch der Einnahme mit den Mahlzeiten (hierdurch allerdings verminderte Resorption)
- bei weiter anhaltenden Beschwerden Wechsel auf anderes Präparat
- Wechsel von Eisen(II)- zu Eisen(III)-Präparat kann helfen.3
- Wechsel von Tropfen zu Tabletten oder umgekehrt kann erwogen werden.3
- Interaktionen: Gabe von Eisen hemmt die Aufnahme von bestimmten Medikamenten (z. B. L-Thyroxin, Einnahmezeitpunkte trennen) und Mineralstoffen (Ca, Mg, Zn).
- häufig gastrointestinale Beschwerden bei oraler Therapie
Parenteral
- Lediglich bei schweren und oral nicht behandelbaren Resorptionsstörungen indiziert
- Präparat: Eisencarboxymaltose
- Dosierung und Verabreichung
- Abhängig vom ermittelten Eisenbedarf, eine Einzeldosis sollte folgende Werte nicht überschreiten: 20 mg Eisen/kg und max. 1.000 mg (Verabreichung als intravenöse Infusion).
- Erfahrung und Ausstattung für Erste Hilfe und Wiederbelebungsmaßnahmen erforderlich (Gefahr der Anaphylaxie bei i. v. Gabe von Eisen)3
Prävention
- Schwangere
- Gewährleistung eines ausreichenden Eisenstatus bei Schwangeren mit Eisenmangel zur Vermeidung des Eisenmangels des Kindes
- Frühgeborene (insbesondere mit Geburtsgewicht < 2.500 g)
- 2–2,5 mg/kg tgl. ab der 8. Lebenswoche bis zum 12.–15. Lebensmonat
- Eine frühere Eisensubstitution wird wegen der noch nicht ausgereiften intestinalen Regulation der Eisenaufnahme nicht empfohlen.
- Kinder mit normalem Eisenstatus
- Prophylaktische Eisengabe bei nicht frühgeborenen Kindern ist unnötig und sogar kontraindiziert, da dies nachteilige Effekte auf das Wachstum haben kann.
Verlauf, Komplikationen und Prognose
Komplikationen
- Gastrointestinale Beschwerden bei oraler Substitution
- Schwere Überempfindlichkeitsreaktion mit Schock bei i. v. Verabreichung von Eisen
- Paravasat mit Hautverfärbung bei i. v. Verabreichung
Prognose und Verlauf
- Die Prognose eines alimentären Eisenmangels ist bei adäquater Therapie gut.
Verlaufskontrolle
- Kontrolle des Ferritins nach 3 Monaten
- Bei schwerem Eisenmangel/Anämie Objektivierung von:
- Retikulozytenkrise 5–7 d nach Substitutionsbeginn
- erwarteter Hb-Anstieg von 1–2 g/dl pro Woche.
Patienteninformationen
Patienteninformationen in Deximed
Illustrationen
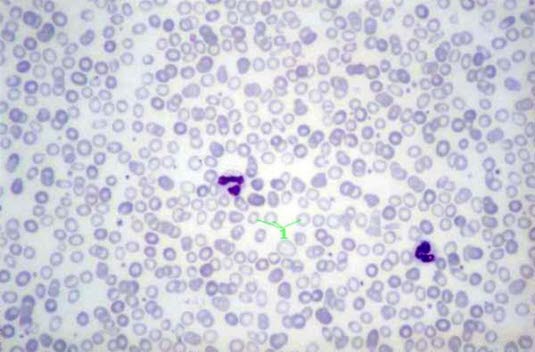
Eisenmangelanämie, Blutausstrich
Quellen
Literatur
- Zimmermann M. Global look at nutritional and functional iron deficiency in infancy. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2020; 2020: 471-477. doi:10.1182/hematology.2020000131 DOI
- Gattermann N, Muckenthaler M, Kulozik A, et al. The evaluation of iron deficiency and iron overload. Dtsch Arztebl Int 2021; 118: 847-856. doi:10.3238/arztebl.m2021.0290 DOI
- Mattiello V, Schmugge M, Hengertner H, et al. Diagnosis and management of iron deficiency in children with or without anemia: consensus recommendations of the SPOG Pediatric Hematology Working Group. Eur J Pediatr 2020; 179: 527-545. doi:10.1007/s00431-020-03597-5 DOI
Autor*innen
- Lino Witte, Dr. med., Arzt in Weiterbildung, Allgemeinmedizin, Münster
- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.