Zusammenfassung
- Definition:Flüssigkeitsgefüllter Hohlraum des Ovars. Eine Ovarialzyste kann aus einer oder mehreren Kammern bestehen und einen serösen oder mukösen Inhalt aufweisen.
- Häufigkeit:Relativ häufig, ca. 10 % prämenopausal und ca. 7 % postmenopausal.
- Symptome:Meist asymptomatisch, können aber auch Drucksymptome oder Zyklusunregelmäßigkeiten verursachen oder bei akuten Komplikationen in Form von Ruptur, Blutung oder Torsion zu akuten Bauchschmerzen führen.
- Befunde:Häufig zufällige Entdeckung bei gynäkologischer Untersuchung als palpierbare Raumforderung oder per Ultraschall, bei Komplikationen druckschmerzhaftes Abdomen.
- Diagnostik:Diagnose durch Ultraschall.
- Therapie:Meist zunächst abwartende Therapie. Patientinnen mit Zysten unklarer Dignität, insbesondere postmenopausale Frauen mit größeren und komplexen Zysten, werden jedoch zum Ausschluss eines Malignoms operiert.
Allgemeine Informationen
Definition
- Zumeist gutartige, flüssigkeitsgefüllte Hohlräume, die von den Ovarien ausgehen.1
Häufigkeit
- Weltweit haben 7 % der Frauen irgendwann im Laufe des Lebens eine Ovarialzyste.
- Prävalenz in den USA 3–15 %.1
- Sonografisch finden sich Ovarialzysten bei mindestens 7 % aller Frauen sowohl prä- als auch postmenopausal.
Ätiologie und Pathogenese
- Ovarialzysten können unterschiedliche Ursachen haben – von normalen physiologischen Prozessen bis zu genetischen Mutationen und malignen Tumoren.
Physiologische Zysten
- Physiologische Zysten sind bis zu 3 cm groß und zyklusabhängig.
Pathologische Zysten
- Follikelzyste
- Funktionelle Zyste, die eine pathologische Veränderung darstellt.
- Entsteht aufgrund von ausbleibender Ruptur oder Fehlern in der Entwicklung persistierender Graaf-Follikel.2
- Können einzeln oder multipel auftreten.
- Sonografisch einkammrige, echoleere, glatt begrenzte Zyste von 3–8 cm, die nach der Ovulation persistiert.
- Follikelzysten und Corpus-luteum-Zysten sind die häufigsten Zysten des Ovars bei der geschlechtsreifen Frau.
- besonders häufig nach der Menarche und kurz vor der Menopause
- Sind mit Schmerzen und Zyklusstörungen assoziiert.
- Können bei großer Größe eine Stieldrehung begünstigen.
- Spontanremission in mehr als 90 % der Fälle.
- Bei Persistenz > 3–6 Monate sollte eine operative Abklärung erwogen werden.
- Rezidivgefahr hoch
- Corpus-luteum-Zysten
- Entstehen aus dem Graaf-Follikel 2–4 Tage nach der Ovulation.1
- Durchmesser von 4–8 cm
- Müssen vom Corpus luteum menstruationis (2–3 cm) und vom Corpus luteum graviditatis abgegrenzt werden.
- häufiges Vorkommen bei der Frau in der Reproduktionsphase
- Sonografisch zeigt sich eine einkammrige, glatt begrenzte, häufig eingeblutete Zyste. Durch die Einblutung sind ggf. netzartige Binnenechos darstellbar.1
- Die Progesteronproduktion in der Zyste kann zur Störung des Menstruationszyklus führen.
- Granulosa-Theka-Luteinzysten
- Entstehen als Folge einer hohen Choriogonadotropin-Konzentration.
- Ursächlich sind die Stimulierung mit Gonadotropinen oder Clomifen (Antiöstrogen) bei Infertilität, daneben die Schwangerschaft sowie Trophoblasttumoren.3 Die Stimulationsbehandlung ist die häufigste Ursache.1
- Luteinzysten können bis zu 20 cm groß werden.
- Das Absetzen der Hormonzufuhr eliminiert die Granulosa-Theka-Luteinzysten.
Syndrom polyzystischer Ovarien (PCO-Syndrom)4
- Das PCO-Syndrom (engl. Polycystic Ovary Syndrome, PCOS) ist ein Symptomkomplex aus polyzystischen Ovarien, chronischen Zyklusstörungen in Form von Oligo- oder Amenorrhö (aufgrund von Oligo- oder Anovulation), Virilisierung (bedingt durch zu hohen Androgenspiegel).
- Per definitionem müssen nicht alle Kriterien gleichzeitig vorliegen.
- Typisches sonografisches Bild polyzystischer Ovarien
- > 7 subkapsuläre Ovarialzysten mit einem maximalen Querschnitt von 10 mm und relative Zunahme des Ovarialstromas
- Häufige Folge: Infertilität
- Therapie siehe Artikel PCO-Syndrom.
Gutartige Ovarialtumoren
- Endometriosezysten
- Zysten mit endometriumartigen Zellverbänden in der Zystenwand
- sog. „Schokoladenzysten“
- neben der Endometriosezyste des Ovars ggf. weitere typische Symptome einer Endometriose
- Eher keine eigenständige Rückbildung, keine Zystenruptur und keine Stieldrehung aufgrund der Dicke des Zystenbalgs und der Adhäsionen zu erwarten.
- ggf. Observatio zunächst entsprechend der Beobachtung bei Follikelzysten
- operative Entfernung bei Klinik und/oder Progredienz
- Zystadenome
- vom Oberflächenepithel ausgehende Tumoren des Ovars
- gutartig
- Treten am häufigsten vom 40. bis zum 60. Lebensjahr auf.
- sonografisch ein- oder mehrkammrige, echoarme zystische Tumoren
- Zumeist glatte Zystenwände, papilläre Muster können aber vorkommen. Binnenechos weisen auf muzinöses Zystadenom hin.
- Formen: serös, muzinös, endometroid, hellzellig
- seröse Zystadenome
- ca. 25 % der gutartigen Ovarialtumoren
- in 20 % aller Fälle bilateral
- Können groß werden.
- muzinöse Zystadenome
- 25–40 % der gutartigen Ovarialtumoren
- Treten am häufigsten im Alter von 20–40 Jahren auf.
- in 2–5 % aller Fälle bilateral
- Können sehr groß werden.
- Können benigne (80 %), borderline (16–17 %) oder selten maligne sein.5
- Brenner-Tumor (Transitionalzelltumor)
- Teratome
- Enthalten Anteile aller 3 Keimblätter.
- Reife, unreife und embryonale (zumeist maligne) Formen werden unterschieden.
- reifes zystisches Teratom (Dermoidzyste)7
- ca. 10–20 % der gutartigen Ovarialtumoren
- in 10–12 % der Fälle bilateral
- kann jede Altersklasse betreffen, hauptsächlich aber im reproduktiven Alter vorkommend
- in den Tumoren kommen unterschiedliche Gewebetypen vor: Plattenepithel, Talgdrüsen, Zähne, Haare
- sehr kleine (< 1 cm) bis mäßig große (> 10 cm) Varianten kommen vor
- häufig Zufallsbefund i. R. der gynäkologischen Vorsorge
- typisches sonografisches Bild: inhomogene Zyste mit echoarmen und echoreichen Strukturen
- Thekome
- Gehen vom Ovarialstroma aus.
- Sind benigne.
- Produzieren Östrogen und führen zu postmenopausalen Blutungen.
- Fibrome
- Gehen von den Fibroblasten des Ovarialstomas aus.1
- Sind nicht hormonproduzierend.
- Komplikation: Meigs-Syndrom mit Aszites, Pleuraerguss und Ovarialfibrom
- Sertoli-Leydig-Zell-Tumoren (Androblastome)8
- Sind selten.
- Sind häufig benigne, können auch maligne sein.
- endokrine Manifestationen möglich:
- Virilisierung (Androgenproduktion)
- Cushing-Syndrom (Steroidproduktion)
- selten Östrogenproduktion.
ICPC-2
- X80 Gutartiger Tumor in den weiblichen Geschlechtsorganen IKA
ICD-10
- N83 Nicht-entzündliche Beschwerden in den Eierstöcken, Eileitern und dem Ligamentum latum uteri
- N83.0 Follikelzyste im Eierstock
- N83.2 Andere und nicht spezifizierte Ovarialzysten
- N83.9 Unspezifizierte, nicht-inflammatorische Beschwerden in den Eierstöcken, Eileitern und dem Ligamentum latum uteri
- D27 Gutartiger Tumor im Ovarium
Diagnostik
Diagnostische Kriterien
- Nachweis eines zystischen Tumors in einem oder beiden Ovarien
Differenzialdiagnosen
- Ovarialkarzinom
- Maligne Keimstrangtumoren
- Extrauteringravidität
- Tuboovarialabszess
- Paraovarialzysten: Entstehen aus Resten des Mesonephros, des Wolff-Gangs. Im Ligamentum latum uteri lokalisiert.
- Hydrosalpinx
- Myome
Anamnese
- Ovarialzysten werden häufig als Zufallsbefund bei asymptomatischen Frauen entdeckt.1
- Mögliche Symptome
- Zyklusunregelmäßigkeiten
- Drucksymptome bei größeren Zysten: Bauchschmerzen, Druckgefühl, Stuhlunregelmäßigkeiten, Miktionsauffälligkeiten (Drangsymptomatik)
- Bauchumfangsvermehrung
- Virilisierung bei Androgenproduktion
- akute Bauchschmerzen bei Stieldrehung, Blutung, Ruptur
Klinische Untersuchung
- Große Zysten können abdominal palpiert werden.
- Gynäkologische Untersuchung durch Gynäkolog*in
Weitere Untersuchungen in der Hausarztpraxis
- Bei unspezifischen Unterbauchbeschwerden der Frau
- Labor mit kleinem Blutbild, CRP, GOT, GPT, GGT, Lipase, Kreatinin, Natrium, Kalium
- abdominelle Sonografie
- ggf. Urikult
Diagnostik bei Spezialist*innen
- Gynäkologische Untersuchung und (transvaginaler) Ultraschall
- Größe des Tumors (mit der Größe steigt die Malignitätswahrscheinlichkeit)
- Kammern? Binnenstrukturen?
- Solide Anteile?
- Septen? Septen > 3 mm kann Hinweis auf Malignität sein.
- Dichte der Zystenflüssigkeit?
- Aszites?
- Vergrößerung der Ovarien, freie Flüssigkeit, duplexsonografisch ovarielle Durchblutungsstörungen bei V. a. Torsion1
- Ggf. MRT, v. a. bei Zysten mit soliden Anteilen, zur weiteren Abklärung der Dignitiät9
- Ggf. Bestimmung von Ca-125
- Cave: Nur 50 % der Frauen in frühen Tumorstadien weisen einen erhöhten Ca-125-Wert auf!1
Indikationen zur Einweisung/Überweisung
- Zu Gynäkolog*in bei V. a. eine Ovarialzyste zur Mitbeurteilung und Verlaufsbeobachtung oder Therapie
- Bei akuten Unterbauchschmerzen mit V. a. rupturierte oder stielgedrehte Ovarialzyste sofortige stationäre Einweisung
Therapie
Therapieziele
- Ziel ist, das Risiko einer malignen Entartung und die Notwendigkeit der operativen Entfernung zu bestimmen.1
Allgemeines zur Therapie
- Chirurgischer Eingriff oder Beobachtung?
- „Watchful Waiting“ wird zumeist empfohlen.
- 89 % der funktionellen Adnexbefunde sind in der Prämenopause spontan regredient, sodass ein observierendes Verhalten gerechtfertigt ist.
- Befunde > 5 cm Größe persistieren zumeist.
- Auch in der Postmenopause kann bei unilokulärem zystischem Befund und fehlenden Malignitätskriterien 2 Monate zugewartet und kontrolliert werden, da in dieser Zeit 36–40 % der Befunde größenregredient sind.
Operative Therapie
- Akutes Krankheitsbild1
- Kann durch Infektion, Blutung, Torsion, Zystenruptur oder Nekrose verursacht werden.
- operative Exploration erforderlich, zunächst laparoskopisch
- Prämenopausale, einfache Zyste
- 1. Wahl: Beobachtung mit regelmäßigen Ultraschalluntersuchungen10
- Prämenopausal, mit komplexer oder solider Ovarialzyste
- Postmenopausale, einfache Zyste1
- bei Zysten < 10 cm und mit normalem CA-125 Beobachtung mit regelmäßigen Ultraschalluntersuchungen je nach Größe alle 2–6 Monate zur Beurteilung einer Größenprogredienz
- bei Größenprogredienz operative Entfernung
- Auch bei großen Zysten ist die Laparoskopie möglich.
- Postmenopausal, komplexe oder solide Ovarialzyste
- Die Zyste sollte laparoskopisch entfernt werden.
- bei malignomsuspektem Befund Zugang offen chirurgisch1
- Schwangere mit einfacher oder komplexer Zyste
- Bei fehlenden Malignitätshinweisen und Durchmesser < 8 cm regelmäßige sonografische Beobachtung1
Verlauf, Komplikationen und Prognose
Verlauf
- Nach Resektion Rezidive möglich
Komplikationen
- Torsion, Ruptur oder Blutung mit akutem Abdomen
Prognose
- Die Prognose ist bei sicher gutartigen Befunden gut.
- Ovarialzysten bilden sich häufig zurück.1
- V. a. einfache Zysten prämenopausal sind häufig spontan regredient, komplexe Zysten seltener.
- In der Schwangerschaft bilden sich fast 100 % der einfachen und 70 % der komplexen Zysten zurück.
- Komplexe Zysten bei postmenopausalen Frauen hingegen haben ein relevantes Malignitätsrisiko und sollten deshalb entfernt werden.
Verlaufskontrolle
- Je nach Größe und Echomuster in der Sonografie1,10
- Kleine, einfache Zysten unter 4–5 cm sollten dokumentiert, aber nicht verlaufsbeobachtet werden.
- Größere und komplexe Zysten sollten zur Überprüfung der Dignität und Größenkontrolle alle 2–6 Monate sonografisch kontrolliert werden.1
Patienteninformationen
Worüber sollten Sie die Patientinnen informieren?
- Ovarialzysten kommen häufig vor. In der Mehrzahl der Fälle bilden sie sich spontan zurück. Bei Größenprogredienz, akuter Symptomatik oder weiteren Beschwerden sollten sie operativ entfernt werden.
- Mögliche Symptome
- erhöhter Bauchumfang bei sehr großen Zysten
- Stuhl- oder Miktionsstörungen bei Druck auf Rektum oder Harnblase
- Virilisierung bei hormonproduzieren Zysten
- akute Bauchschmerzen bei Stieldrehung des Ovars, Ruptur oder Blutung
- Falls ein operativer Eingriff erforderlich ist, wird, soweit dies sinnvoll möglich ist, immer versucht, die Eierstöcke zu erhalten.
Patienteninformationen in Deximed
Illustrationen
Dermoid/Teratom
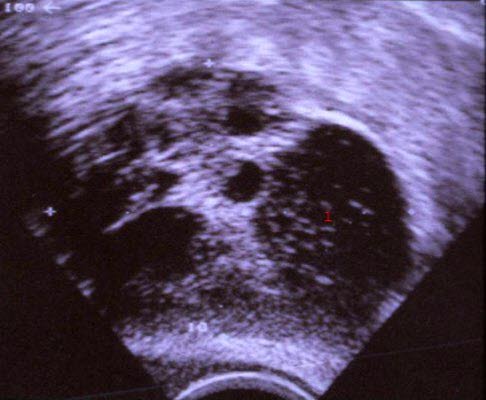
Dermoidzyste, Ultraschall

Bilaterale Dermoide, Operationspräparat
Endometriom
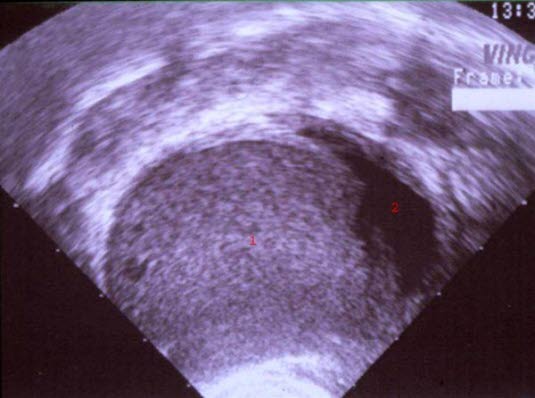
Endometriom, Ultraschall
Solider Ovarialtumor
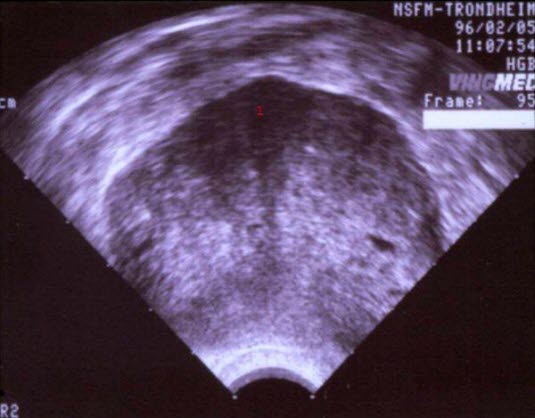
Sertoli-Leydig-Zell-Tumor, Ultraschall
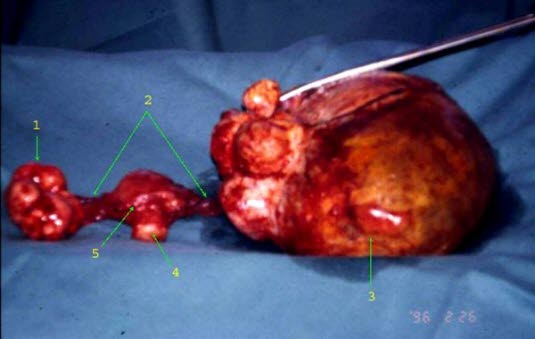
Bilaterale Fibrome, Operationspräparat
Ovarialzysten
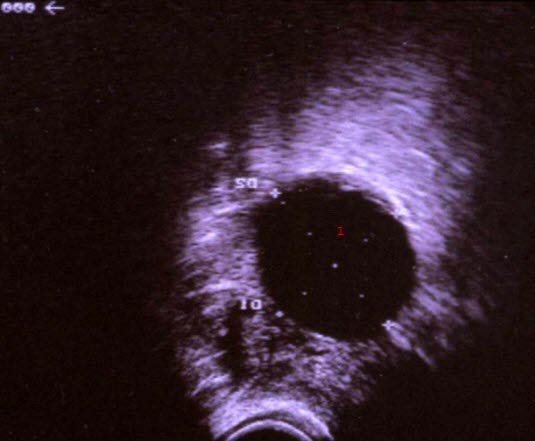
Einfache Zyste, einkammerige, echoarme Zyste, Ultraschall
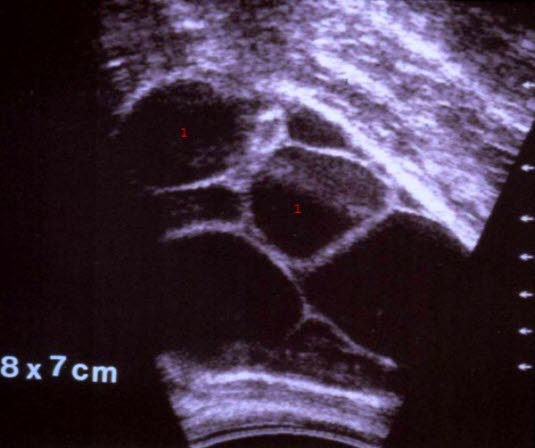
Multilokuläre Zysten: Granulosa-Theka-Luteinzyste, Ultraschall
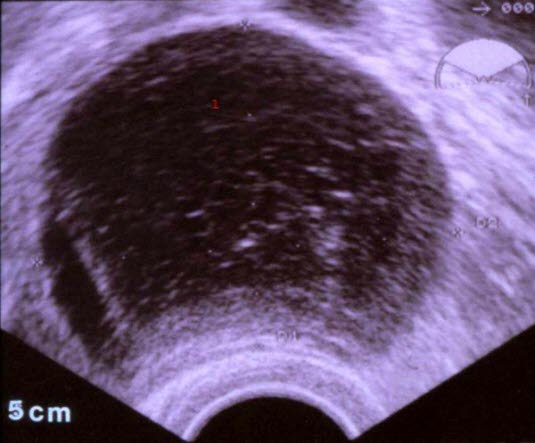
Komplexe Zyste: Hämorrhagische Zyste, Ultraschall
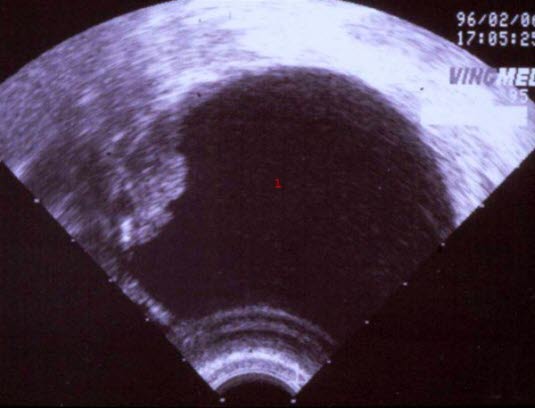
Komplexe Zyste: Zystadenofibrom, Ultraschall

Komplexe Zyste: Degeneratives Myom, Ultraschall
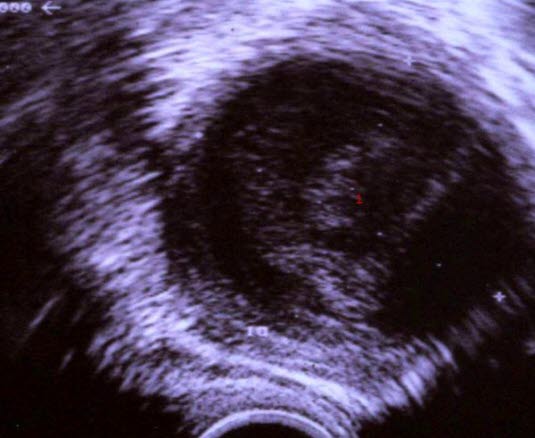
Komplexe Zyste: Tuboovarialabszess, Ultraschall

Komplexe Zyste: Muzinöses Zystadenom, Ultraschall

Gedrehtes, muzinöses Zystadenom, Operationspräparat

Zystischer, solider Tumor: endometrioides Adenokarzinom
Quellen
Literatur
- Singh S. Ovarian cysts. BestPractice, last updated Sept 24, 2021. bestpractice.bmj.com
- Hall GH, Turnbull LW, Richmond I, et al. Localisation of somatostatin and somatostatin receptors in benign and malignant ovarian tumours. Br J Cancer 2002;87:86-90. PubMed
- Shwayder JM. Pelvic pain, adnexal masses, and ultrasound. Semin Reprod Med 2008;26:252-265. PubMed
- Goodarzi MO. Polycystic ovary syndrome. BMJ Best Practice. Last reviewed: last updated: 14 Sep 2021. bestpractice.bmj.com
- Marko J, Marko KI, Pachigolla SL, Crothers BA, Mattu R, Wolfman DJ. Mucinous Neoplasms of the Ovary: Radiologic-Pathologic Correlation. Radiographics. 2019 Jul-Aug;39(4):982-997. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Zheng R, Heller DS. Borderline Brenner Tumor: A Review of the Literature. Arch Pathol Lab Med. 2019 Oct;143(10):1278-1280. meridian.allenpress.com
- Pradhan P, Thapa M. Dermoid Cyst and its bizarre presentation. JNMA J Nepal Med Assoc. 2014 Apr-Jun;52(194):837-44. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Chen L, Tunnell CD, De Petris G. Sertoli-Leydig cell tumor with heterologous element: a case report and a review of the literature. Int J Clin Exp Pathol. 2014 Feb 15;7(3):1176-81. www.ncbi.nlm.nih.gov
- Sadowski EA, Maturen KE, Rockall A, Reinhold C, Addley H, Jha P, Bharwani N, Thomassin-Naggara I. Ovary: MRI characterisation and O-RADS MRI. Br J Radiol. 2021 Sep 1;94(1125):20210157. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Levine D, Patel MD, Suh-Burgmann EJ, et al. Simple Adnexal Cysts: SRU Consensus Conference Update on Follow-up and Reporting. Radiology. 2019 Nov;293(2):359-371. pubs.rsna.org
Autor*innen
- Franziska Jorda, Dr. med., Fachärztin für Viszeralchirurgie, Ärztin in Weiterbildung Allgemeinmedizin, Kaufbeuren