Allgemeine Informationen
Definition
- Raumforderungen im Becken können gynäkologische oder nicht-gynäkologische Ursachen haben, in der Mehrzahl benigne, aber auch maligne sind Ursachen möglich.1
- Raumfordernde Prozesse im Becken werden mithilfe von Ultraschall als zystisch, solide oder komplex eingestuft.
Häufigkeit
- Bei postmenopausalen Frauen werden 30 % aller raumfordernden Prozesse im Becken durch eine Krebserkrankung verursacht.2
- Bei schwangeren Frauen ist die häufigste Ursache eine Corpus-luteum-Zyste. Bei nicht schwangeren Frauen sind die häufigsten Ursachen funktionelle Zysten und Myome.3
- Unter 18 Jahren sind 25 % der Raumforderungen im Bereich der Adnexe maligne.1
- Ovarialkarzinom
- Ist die häufigste Ursache für einen tödlichen Verlauf einer gynäkologischen Krebserkrankung.
- Die Inzidenz steigt mit dem Alter.
- Das Risiko, an einem Ovarialkarzinom zu sterben, liegt über das gesamte Leben hin gesehen bei 1,4 %.3
Diagnostische Überlegungen
- Das Risiko einer malignen Erkrankung steigt mit dem Alter.
- Bei erhöhtem Bauchumfang, möglichem Aszites und Druckschmerzen im Unterleib besteht bis zum Beweis des Gegenteils der Verdacht auf ein Ovarialkarzinom.
- Uterusmyome sind häufig, ggf. knotige Veränderungen tastbar, Diagnose durch Ultraschall.
Konsultationsgrund
- Vorstellungsgründe können abnorme uterine Blutungen, abdominelle Schmerzen, Verdauungsstörungen mit Blähungen, Obstipation oder Stuhlunregelmäßigkeiten oder urologische Symptome sein.
Abwendbar gefährliche Verläufe
ICD10
- D39 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane
- D39.0 Uterus
- D39.1 Ovar
Differenzialdiagnosen
Vergrößerter Uterus
Schwangerschaft
- Häufigste Ursache für einen vergrößerten Uterus
- Positiver Beta-hCG-Test
Uterusmyome
- Häufigster gutartiger Tumor der Frau
- Klinisch relevante Myome finden sich bei etwa 25–30 % aller Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren.
- In 50 % keine Symptome, Zufallsbefunde
- Die häufigsten Symptome sind abnorme uterine Blutungen (Zwischenblutungen, starke Blutungen), Dyspareunie, Pollakisurie, Obstipation, unerfüllter Kinderwunsch.
- Bei der bimanuellen Palpation werden ggf. ein oder mehrere eindeutig abgegrenzte Tumoren oder ein vergrößerter, knotenartiger Uterus ertastet.
- Die Diagnose wird durch Ultraschalluntersuchung bestätigt.
Endometriumkarzinom
- Bei 90 % der betroffenen Frauen tritt die Erkrankung nach der Menopause auf.4
- früheres Auftreten fast ausschließlich bei Frauen mit polyzstischem Ovarialsyndrom
- Leitsymptom postmenopausale Blutung
- bei prämenopausalen Frauen unregelmäßige Blutungen
- Schmerzen treten erst in einem späten Stadium auf.
- Evtl. verdicktes Endometrium im transvaginalen Ultraschall
- Die Diagnose wird mittels Hysteroskopie, fraktionierter Abrasio und histologischer Aufarbeitung des Abradats gestellt.
Zervixkarzinom
- Mittleres Erkrankungsalter 55 Jahre, Anstieg der Inzidenz ab 30 Jahren
- Wichtigste Ursache ist die Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV).
- Entstehung über dysplatische Vorläuferläsionen
- Symptome
- anfangs häufig asymptomatisch
- anomale vaginale Blutungen (Zwischenblutungen, postkoitale Blutungen, postmenopausale Blutungen)
- auffälliger Ausfluss: wässrig, purulent, blutig oder übelriechend
- Im frühen Stadium meist keine sicht- oder tastbaren Befunde
- Die Diagnose lässt sich in der Regel durch eine Zervixzytologie, Portiobiopsie oder zervikale Abrasio bestätigen.
Blasenmole
- Es handelt sich um einen benignen Trophoblasttumor, bei dem es in der Plazenta zu einer blasenartigen Umwandlung der Plazentazotten kommt.
- Entsteht in der befruchteten Eizelle.
- komplett: ohne fetales Gewebe
- partiell: mit fetalem Gewebe
- Die Schwangerschaft kann zunächst fortbestehen, endet aber wegen embryonaler Fehlbildungen mit einer Fehlgeburt.
- Symptome sind Blutungen und Hyperemesis aufgrund hoher Beta-hCG-Werte.
- Der Uterus ist meist größer als in einem vergleichbaren Stadium einer gesunden Schwangerschaft.
- Der Beta-hCG-Wert ist erhöht und der Ultraschallbefund ist typisch.
Invasive Blasenmole (Mola destruens)
- Maligner Trophoblastentumor, der in das Myometrium wächst und zu einer hämatogenen Streuung und Fernmetastasen führen kann.
- Die Symptome sind meist nicht gynäkologischer Art: Metastasen in Lunge und Gehirn, Vagina und Adnexe.
- Der Beta-hCG-Wert ist erhöht.
Chorionkarzinom
- Die Erkrankung ist sehr selten.
- Maligner Trophoblasttumor, der nach allen Schwangerschaftsarten auftreten und metastasieren kann.
- in 50 % der Fälle Auftreten nach Blasenmole
- Symptome
- abnorme Blutungen
- Symptome durch Metastasen
- Symptome durch erhöhtes Beta-hCG (Übelkeit, Erbrechen)
- Der Beta-hCG-Wert ist erhöht.
Pathologische Adnexe
Ovarialzysten
- Ovarialzysten treten häufig auf.
- Sie werden meist zufällig bei einer gynäkologischen Untersuchung oder im Ultraschall entdeckt.
- Mögliche Symptome5
- Zyklusunregelmäßigkeiten
- Drucksymptome bei größeren Zysten: Bauchschmerzen, Druckgefühl,
- Stuhlunregelmäßigkeiten, Miktionsauffälligkeiten (Drangsymptomatik)
- Bauchumfangsvermehrung
- Virilisierung bei Androgenproduktion
- akute Bauchschmerzen bei Stieldrehung, Blutung, Ruptur
- Diagnose durch Sonografie
Ovarialkarzinom
- Mittleres Erkrankungsalter 69 Jahre.
- Symptome
- Völlegefühl
- Blähungen
- unklare abdominelle Schmerzen oder Beschwerden
- Zunahme der Miktionsfrequenz
- erhöhter Bauchumfang
- Gewichtsverlust, reduzierter Allgemeinzustand
- Im fortgeschrittenen Stadium ggf. tastbare harte, unregelmäßige, feste Resistenz Oberbauch im Bereich des Omentum majus („Omental Cake“).
- Die Diagnose wird aufgrund von klinischen Befunden, verdächtigen Ultraschalluntersuchungen und erhöhtem CA-125 vermutet. Sie wird histologisch im Rahmen der Operation bestätigt.
- Ultraschall mit Befund eines soliden Adnextumors in Kombination mit CA-125-Wert > 35 Einheiten/ml weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Ovarialkarzinom hin.6
Extrauteringravidität
- Die Einnistung einer befruchteten Eizelle erfolgt außerhalb der Gebärmutterhöhle (ektopisch) oder außerhalb des Uterus (extrauterin).
- in 90 % d. F. Eileiterschwangerschaften
- Symptome
- Unterbauchschmerzen
- ausgebliebene Menstruation
- leichte Vaginalblutung in der ca. 6.–8. SSW
- Komplikationen
- Tubenruptur mit hämorrhagischem Schock oder Peritonitis
- Prädiktoren sind:
- frühere Eileiteroperation
- vorhergegangene ektope Schwangerschaft
- Z. n. Entzündungen im Bereich des kleinen Beckens (Pelvic Inflammatory Disease, PID)
- Schwangerschaft nach jeglichen Verfahren der assistierten Reproduktion
- Alter > 40 Jahre
- Schwangerschaft bei einliegendem Intrauterinpessar
- Die Diagnose wird durch den Nachweis einer Extrauteringravidität durch Ultraschall oder Laparoskopie bestätigt.
Metastasen in den Eierstöcken
- Selten
- Ursache ist meist eine Krebserkrankung im Gastrointestinaltrakt oder der Brust.
- Die Symptome ähneln denen eines Ovarialkarzinoms.
Ovarialtorsion7
- Durch die Drehung des Ovars kompromittierte Blutzufuhr zum Ovar
- Notfall, rasche Diagnostik und Therapie zur Erhaltung des Ovars notwendig
- Plötzliche Schmerzen im Unterbauch, normalerweise einseitig
- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall möglich
- Deutlicher Druckschmerz in Unterbauch, ggf. Abwehrspannung
- Das Blutbild zeigt in der Regel anfänglich keine Abweichungen, im Verlauf erhöhtes CRP
- Die Diagnose wird klinisch und über den transvaginalen Ultraschall gestellt.
Corpus-luteum-Zyste
- Entstehen aus dem Graaf-Follikel 2–4 Tage nach der Ovulation5
- Bluten oft spontan ein.
- Können sowohl bei schwangeren als auch nicht schwangeren Frauen auftreten.
Wanderniere
- In seltenen Fällen kann eine Wanderniere im kleinen Becken in der Sonografie dargestellt werden.
Tumor im Colon sigmoideum
- Die Erkrankung verläuft oft symptomfrei.
- Mögliche Symptome
- rektale Blutungen
- Veränderungen der Stuhlgewohnheiten
- Die Diagnose erfolgt durch Koloskopie und Histologie.
Anamnese
- Blutungsstörungen
- je nach Alter Verdacht auf Myom, Ovarialzyste, Schwangerschaft, Zervixkarzinom oder Endometriumkarzinom
- Gewichtsabnahme oder schlechter Allgemeinzustand
- Hinweis auf maligne Ursache
- Veränderter Scheidenausfluss
- Hinweis auf Infektion, Zervixkarzinom oder Endometriumkarzinom
- Schmerzen
- Ovarialkarzinom: diffuse Schmerzen
- progressiv verlaufender Schmerz mit Fieber, Übelkeit und purulentem Ausfluss: Hinweis auf Beckenentzündung (PID)
- akute Schmerzen: Ovarialtorsion, Blutung oder Ruptur von Ovarialzysten oder ektope Schwangerschaft
- Dyspareunie, Schmerzen, die bei der Menstruation zunehmen: Hinweis auf Endometriose.
- Dysmenorrhö und Menorrhagie sind eher Anzeichen eines Uterusmyoms.
Sonstiges
- Blähbauch und erhöhter Bauchumfang können auf ein Ovarialkarzinom hindeuten.
- Völle- und Druckgefühl treten auch bei Ovarialzysten und Myomen auf.
- Frühere Operationen im Unterleib?
- Verwendung einer Spirale? Erhöhtes Risiko einer ektopen Schwangerschaft
Klinische Untersuchung
- Allgemeinzustand der Patientin
- Kontrolle der Lymphknoten am Hals, oberhalb des Schlüsselbeins, in den Achselhöhlen und in der Leiste
- Lunge abhören, Anzeichen eines Pleuraergusses?3
- Bauch
- Untersuchung auf Aszites, Resistenzen, Hepatosplenomegalie, Palpationsempfindlichkeit, erhöhten Taillenumfang
Ergänzende Untersuchungen
In der Hausarztpaxis
- Angezeigte Tests können Hb, BSG und Leberfunktionstests (GGT, AP, GOT, GPT, Bilirubin, CHE, Quick, PTT) sein.
- Ggf. Schwangerschaftstest (Beta-hCG im Urin)
- CA-125
- Nur als Verlaufsparameter geeignet, CA 125-Bestimmung ist Standard.
- Erhöhte Werte (> 35 Einheiten) deuten auf Malignität hin, aber in der frühen Krankheitsphase ist die Untersuchung weder sensitiv oder spezifisch.
- erhöht bei 90 % der Frauen mit weit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom, aber nur bei 50 % der Betroffenen mit lokal begrenztem Tumor
Bei Spezialist*innen
- Gynäkologische Untersuchung (bimanuelle Palpation)
- Größe des Uterus und der Adnexe
- Beweglichkeit des Uterus und der Adnexe
- Konsistenz
- Abgrenzung
- Schmerzempfindlichkeit
- mögliche Myome
- Ultraschall mit Vaginalsonde
- Standardverfahren bei der Untersuchung von Raumforderungen im kleinen Becken8
- Größe
- Eigenschaften (zystisch, solide, komplex)
- Vorhandensein von Flüssigkeit (Blut oder Aszites)
- Einfache Zysten bei prämenopausalen Frauen gelten als benigne.9
- Komplexe Resistenzen sind bei prämenopausalen Frauen selten maligne.3
- Meist hämorrhagische Zysten oder Endometriome, aber auch ein tuboovarieller Abszess, eine ektope Schwangerschaft oder Ovarialtorsion können sich als komplexe Masse zeigen.
- Bei soliden Raumforderungen handelt es sich meist um ein pedunkuläres Myom, aber auch ein Ovarialtumor, Fibrom, Thekom, Ovarialkarzinom oder eine Ovarialtorsion kommen infrage.
- Standardverfahren bei der Untersuchung von Raumforderungen im kleinen Becken8
- Ggf. MRT zur weiteren diagnostischen Eingrenzung
- Ggf. Koloskopie bei V. a. Kolonkarzinom
Maßnahmen und Empfehlungen
Indikation zur Überweisung
- Bei bisher unbekannter tastbarer Resistenz oder Ultraschallbefund einer Raumforderung im kleinen Becken Überweisung in die gynäkologische Praxis zur weiteren Diagnostik
Illustrationen
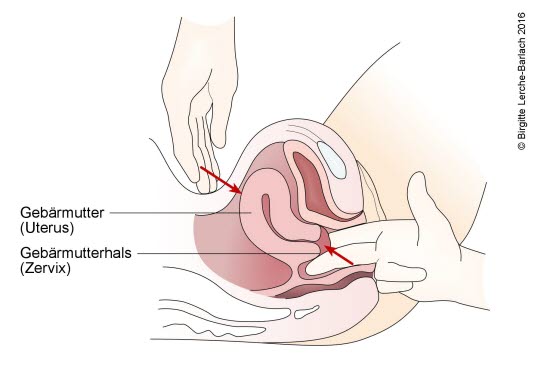
Palpation der Gebärmutter
Quellen
Literatur
- Biggs WS, Marks ST. Diagnosis and Management of Adnexal Masses. Am Fam Physician. 2016 Apr 15;93(8):676-81. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Kinkel K, Lu Y, Mehdizade A, Pelte MF, Hricak H. Indeterminate ovarian mass at US: incremental value of second imaging test for characterization—meta-analysis and Bayesian analysis. Radiology 2005; 236: 85–94. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Givens V, Mitchell G, Harraway-Smith C, Reddy A. Diagnosis and management of adnexal masses. Am Fam Physician 2009; 80: 815-20. American Family Physician
- Sorosky JI. Endometrial cancer. Obstet Gynecol 2008; 111: 436-47. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Singh S. Ovarian cysts. BestPractice, last updated Sept 24, 2021. last reviewed 30 Mar 2023. bestpractice.bmj.com
- Falcone T. Adnexal masses: when to observe, when to intervene, and when to refer. Obstet Gynecol 2010; 115: 680-1. PubMed
- Ovarian torsion. BMJ Best Practice, Last reviewed: 30 Mar 2023, Last updated: 18 Jan 2022. bestpractice.bmj.com
- American College of Obstetricians and Gynecologists. Management of adnexal masses. Obstet Gynecol 2007; 110: 201-14. PubMed
- Bohm-Velez M, Fleischer AC, Andreotti RF, et al., for the Expert Panel on Women’s Imaging. Suspected adnexal masses. Reston, Va.: American College of Radiology (ACR); 2005. Accessed August 3, 2009. www.guidelines.gov
Autor*innen
- Franziska Jorda, Dr. med., Fachärztin für Allgemeinmedizin und für Viszeralchirurgie, Kaufbeuren