Zusammenfassung
- Definition:Entzündliche Erkrankung der Pleurablätter, die als trockene Entzündung (Pleuritis sicca) oder mit Ansammlung von Exsudatflüssigkeit im Pleuraraum (Pleurits exsudativa) auftreten kann, selten Verlauf hin zum Pleuraempyem.
- Häufigkeit:Keine genauen Daten, am häufigsten dürfte das Auftreten im Rahmen von Pneumonien sein.
- Symptome:Bei Pleuritis sicca stechender, atemabhänger Schmerz. Mit Entwicklung eines Pleuraergusses Schmerzabnahme, evtl. Dyspnoe.
- Befunde:Schonatmung. Perkutorisch Dämpfung bei Pleuraerguss. Auskultatorisch bei Pleuritis sicca Reibegeräusch, bei Pleuraerguss abgeschwächtes Atemgeräusch.
- Diagnostik:Röntgenthorax, Sonografie, Labor (Entzündungsparameter), evtl. Punktion und Diagnostik eines Pleurarergusses.
- Therapie:Therapie der Grunderkrankung. Symptomatisch NSAR gegen Entzündung und Schmerz. Punktion/Drainage großer Pleuraergüsse.
Allgemeine Informationen
Definition
- Akut, subakut oder chronisch verlaufende entzündliche Erkrankung der Pleurablätter
- Auftreten möglich:
- als trockene Entzündung (Pleuritis sicca)
- mit Ansammlung von Exsudatflüssigkeit im Pleuraraum (Pleuritis exsudativa)
- als Pleuraempyem.
Häufigkeit
- Keine genauen Daten zur Epidemiologie der Pleuritis
- Pleuritiden im Rahmen von Pneumonien dürften am häufigsten sein.1
- Bei ca. 20–50 % der Patient*innen mit ambulant erworbener Pneumonie wird bei Diagnose oder im Verlauf ein Pleuraerguss als Manifestation der Pleuritis festgestellt.
- 10 % dieser Patient*innen mit komplizierten Ergüssen/Empyem
- Im Übrigen abhängig von der Häufigkeit weiterer Ätiologien
Ätiologie
Primär pulmonale Erkrankungen
- Primäre Lungenerkrankungen stehen bei der Mehrzahl der Pleuritiden ätiologisch im Vordergrund.
- Infektionen
- Virusinfektionen
- Coxsackie-Virus (Morbus Bornholm)
- Echovirus
- RS-Virus
- Influenza-Virus
- Epstein-Barr-Virus
- Zytomegalie-Virus
- Parainfluenza-Virus
- bakterielle Infektionen
- Pneumokokken
- Streptokokken
- Staphylokokken
- gramnegative Bakterien (z. B. Pseudomonas, Enterobacter)
- Tuberkulose
- Anaerobier
- Pilzinfektionen
- Virusinfektionen
- Malignome
- Bronchialkarzinom
- Pleuramesotheliom (Asbestose)
- Eine Asbestpleuritis kann auch ohne maligne Entartung auftreten.
- Traumata
- z. B. bei Rippenfraktur
Kardiovaskuläre Erkrankungen
- Lungenembolie
- Posttraumatisches Herzsyndrom
- autoimmuner Entzündungsprozess unter Einbezug von vor allem Perikard, aber auch Pleura infolge von:
- Postmyokardinfarktsyndrom (Dressler-Syndrom)
- Postperikardiotomiesyndrom
- posttraumatischer Perikarditis (iatrogen nach Interventionen oder nichtiatrogen)
- autoimmuner Entzündungsprozess unter Einbezug von vor allem Perikard, aber auch Pleura infolge von:
- Aortendissektion
Systemische Erkrankungen, Erkrankungen extrathorakaler Organe
- Autoimmunerkrankungen, z. B.:
- Maligne Erkrankung
- metastasierte Tumoren (Mammakarzinom, gastrointestinale Tumoren, Lymphome u. a.)
- Folgen einer Strahlen- oder Chemotherapie
- Hämatogene Streuung in die Pleura bei Infektionen
- Urämie
- Pankreatitis
- Familiäres Mittelmeerfieber
- Sichelzellanämie u. a.
Medikamenteninduziert
- Medikamente können Pleuritis/Pleuraergüsse ohne oder mit parenchymatöser Beteiligung induzieren, z. B.:2-3
- Zytostatika
- Amiodaron
- Nitrofurantoin
- u. v. a.
Idiopathische Pleuritis
- Selten
- Ausschlussdiagnose nach Abklärung anderer Ätiologien
Pathogenese
Physiologie
- Die Pleuren umgeben die Lunge als Doppelhaut, gebildet aus der parietalen Pleura (Rippenfell) und der viszeralen Pleura (Lungenfell).
- Die Pleuren bewirken,
- dass sich die Lunge nicht von der Brustwand lösen kann.
- durch Gegeneinandergleiten, dass Lunge und Brustkorb sich im Rahmen der Atmung gegeneinander bewegen können.
- Die Gleitbewegung der Pleuren gegeneinander wird durch einen dünnen Flüssigkeitsfilm im Pleuraspalt ermöglicht, parietale und viszerale Pleura spielen eine wichtige Rolle bei der Flüssigkeitshomöostase.2
- Normalerweise enthält der Pleuraraum ca. 100 ml klare, eiweiß- und zellarme Flüssigkeit.
- Normalerweise besteht ein Gleichgewicht zwischen Bildung und Resorption von Flüssigkeit; die Resorption erfolgt vor allem über die Lymphgefäße der parietalen Pleura.2
- Die parietale Pleura enthält somatische Schmerzrezeptoren, während die viszerale Pleura keine Schmerzrezeptoren aufweist.4-5
Pathogenese und Manifestationsformen
- Verschiedene lokale und systemische Krankheitsprozesse lösen eine entzündliche Reaktion der Pleuren aus.
- Entzündliche Infiltrationen und Auflagerungen können zum schmerzhaften Aneinanderreiben der Pleuren führen.
- Bei einer entzündlichen Störung der Flüssigkeitshomöostase kommt es zur Entwicklung eines Pleuraergusses.
- Pleuritis sicca
- Initialstadium einer Pleuritis
- pathologisch-anatomisch Entzündungszeichen und Fibrinauflagerungen auf der Pleura
- charakterisiert durch atmungsabhängigen und stechenden Schmerz mit flacher Schonatmung und Reizhusten
- Pleuritis exsudativa
- Pleuritis mit Entwicklung eines Pleuraergusses
- häufig Folgestadium einer initialen Pleuritis sicca
- meistens seröser oder serofibrinöser Erguss
- Nachlassen des pleuritischen Schmerzes durch verminderte Reibung der Pleurablätter
- Pleuraempyem
- Eiteransammlung im Pleuraraum
- schwere Allgemeinsymptome (hohes Fieber, Schüttelfrost)
Zeitliches Auftreten eines pleuritischen Schmerzes abhängig von der Ätiologie4
- Akut (Minuten bis Stunden)
- Lungenembolie
- posttraumatisch
- Subakut (Stunden bis Tage)
- Infektionen
- systemische Entzündungen
- Chronisch
- Malignome
- Tuberkulose
- Rezidivierend
Disponierende Faktoren
- Infektionen
- Systemisch-entzündliche Erkrankungen
- Malignome
ICPC-2
- R82 Pleuritis IKA
ICD-10
- J90 Pleuritis mit Erguss
- R09.1 Pleuritis
Diagnostik
Diagnostische Kriterien
- Klinisches Bild
- Bildgebung bei V. a. Pleuraerguss
Differenzialdiagnosen
- Es gibt zahlreiche Differenzialdiagnosen für Brustschmerz, u. a.:
Anamnese
- Symptome einer Pleuritis
- Schmerzsymptomatik bei Pleuritis sicca4
- stechend, schneidend, brennend
- Intensität von gering bis extrem stark
- häufig gut lokalisiert
- atemabhängig
- Verstärkung bei Inspiration, Husten, Niesen
- Linderung durch Lagerung auf die betroffene Seite (Minderung der Atemexkursion)
- trockener Husten
- Dyspnoe
- vor allem bei Pleuraerguss
- nur lockere Korrelation zwischen Stärke der Atemnot und Größe des Pleuraergusses2
- Schmerzsymptomatik bei Pleuritis sicca4
- Symptome einer Grunderkrankung, u. a.:
- Fieber
- Auswurf
- Gewichtsverlust
- Nachtschweiß
- Gelenkschmerzen
- u. a.
- Medikamente
Klinische Untersuchung
- Inspektion
- Schonatmung
- Tachypnoe
- Perkussion
- erkrankte Seite evtl. klopfempfindlich (Pleuritis sicca)
- Klopfschall
- bei Pleuritis sicca unauffälliger Klopfschall (sofern nicht durch Grunderkrankung verändert), da keine Veränderung des Luftgehalts der Lunge
- gedämpfter Klopfschall bei Pleuraerguss
- Auskultation
- pleuritisches Reiben bei Pleuritis sicca
- in- und exspiratorisch gleich lang
- keine Veränderung nach einem Hustenstoß
- bei älteren, großen Fibrinauflagerungen rau und laut („Lederknarren“)
- bei Entwicklung eines Pleuraergusses Abnahme und schließlich Verschwinden des Pleurareibens
- abgeschwächtes Atemgeräusch über dem Pleuraerguss
- pleuritisches Reiben bei Pleuritis sicca
Ergänzende Untersuchungen in der Hausarztpraxis
Labor
- Blutbild, Differenzialblutbild
- Entzündungsparameter
- Bei entsprechendem Verdacht Labor hinsichtlich:
- systemischer Erkrankungen wie SLE, rheumatoide Arthritis (Serologie)
- Tuberkulose (Sputum).
- Evtl. Labor zum Ausschluss von Differenzialdiagnosen
Sonografie
- Nachweis und Quantifizierung eines Pleuraergusses
- Erfassung von Fibrinauflagerungen, Septierungen
EKG
- Ausschluss von Differenzialdiagnosen (ACS, Perikarditis)
Diagnostik bei Spezialist*innen
Röntgen-Thorax
- Nachweis eines Pleuraergusses
- Nachweis bzw. Ausschluss zugrunde liegender Erkrankungen (Pneumonie, Bronchialkarzinom)
CT
- Erweiterte Diagnostik zum Nachweis/Ausschluss von Differenzialdiagnosen, z. B. Bronchialkarzinom, Lungenembolie
- Erweiterte Diagnostik bei Komplikationen wie Empyem, Lungenabszesse6
Pleurapunktion
- Bei Pleuraerguss unklarer Ätiologie
- Transsudat/Exsudat, Zytologie, Mikrobiologie
Thorakoskopie/Pleurabiopsie
- Im Einzelfall zur ätiologischen Abklärung
Indikationen zur Überweisung/Krankenhauseinweisung
- Die Indikation zu Überweisung oder Krankenhauseinweisung ergibt sich aus der vermuteten Grunderkrankung und der Schwere des Krankheitsbildes.
Therapie
Therapieziele
- Heilung der Pleuritis durch effektive Behandlung einer Grunderkrankung
- Symptomatische Therapie
Allgemeines zur Therapie
- Bestandteile der Therapie sind:
- Behandlung einer Grunderkrankung
- entzündungshemmende und schmerzstillende Medikation
- Punktion/Drainage eines Pleuraergusses7
- Atemgymnastik.
Behandlung von Grunderkrankungen
- Zur Behandlung von Grunderkrankungen einer Pleuritis siehe entsprechende Artikel.
- Infektionen, u. a.:
- Systemerkrankungen, u. a.:
- Malignome, u. a.:
- Kardiovaskuläre Erkrankungen, u. a.:
Entzündungshemmende/schmerzstillende Therapie
- NSAR sind Mittel der 1. Wahl zur Entzündungshemmung und Analgesie.
Punktion/Drainage eines Pleuraergusses
- Details zu Diagnostik und Therapie siehe Artikel Pleuraerguss.
Atemgymnastik
- Besserung der Ventilation
- Vermeidung von Pleuraschwarten
Verlauf, Komplikationen und Prognose
Komplikationen
- Pleuraschwarten
- Pleuraempyem
- Sepsis
- Komplikationen der Grunderkrankungen
Verlauf und Prognose
- Verlauf und Prognose werden von der Grunderkrankung bestimmt.
Verlaufskontrolle
- Verlaufskontrolle von Pleuraergüssen vor allem durch Sonografie
Patienteninformationen
Patienteninformationen in Deximed
Illustrationen
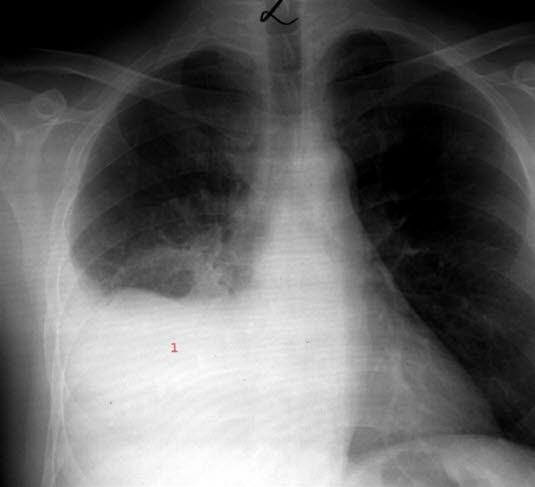
Pleuropneumonie rechts, Röntgenthorax, Übersichtsaufnahme
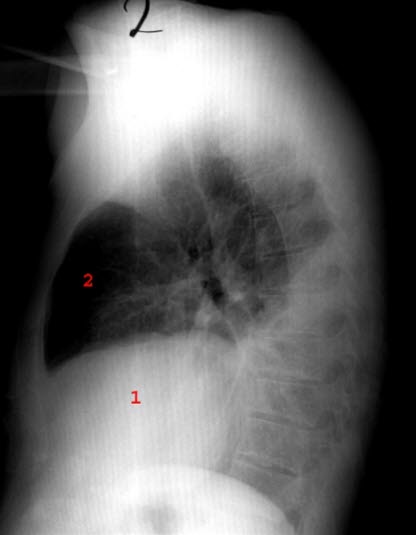
Pleuropneumonie, Seitaufnahme
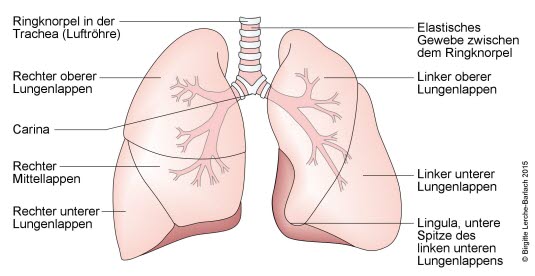
Lunge und Bronchien
Quellen
Literatur
- Assessment of pleuritis. BMJ Best Practice, last updated: 24 Jun 2021. Zugriff 17.07.21. bestpractice.bmj.com
- Jany B, Welte T. Pleural effusion in adults - etiology, diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 377-386. doi:10.3238/arztebl.2019.0377 DOI
- Huggins J, Sahn S. Drug-induced pleural disease. Clinics in Chest Medicine 2004; 25: 141-153. doi:10.1016/S0272-5231(03)00125-4 DOI
- Kass S, Williams P, Reamy B. Pleurisy. Am Fam Physician 2007; 75: 1357-1364. www.aafp.org
- Reamy B, Williams P, Odom M. Pleuritic Chest Pain: Sorting Through the Differential Diagnosis. Am Fam Physician 2017; 96: 306-312. www.aafp.org
- Davies HE, Davies RJO, Davies CWH. Management of pleural infection in adults: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax 2010; 65 (Suppl 2): ii41-ii53. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Pleural effusion. BMJ Best Practice. Last updated: 25 May 2021. Zugriff 17.07.21. bestpractice.bmj.com
Autor*innen
- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.