Zusammenfassung
- Definition:Das Karpaltunnelsyndrom (KTS) ist ein Engpasssyndrom mit Druckschädigung des Nervus medianus bei seinem Durchtritt durch den Karpaltunnel am Handgelenk.
- Häufigkeit:Häufigstes Nervenkompressionssyndrom, betrifft etwa 3–5 % der Bevölkerung. Frauen sind etwa 3- bis 4-mal häufiger betroffen. Der Häufigkeitsgipfel liegt zwischen 40 und 60 Jahren.
- Symptome:Nächtliches Einschlafen und Missempfindungen der Hände ist ein häufiges Erstsymptom (Brachialgia paraesthetica nocturna) mit Besserung durch Ausschütteln; im Verlauf anhaltende Schmerzen und Sensibilitätsstörungen sowie Kraftminderung und Atrophie des lateralen Daumenballens.
- Befunde:Im Frühstadium oft unauffällig; im Verlauf Sensibilitätsstörungen (Berührung, Schmerz, Ertasten). Bei schwerer Ausprägung Kraftminderung des Daumens mit Thenaratrophie. Provokationstests wie das Hoffmann-Tinel-Zeichen und der Phalen-Test liefern zusätzliche Hinweise.
- Diagnostik:Die Diagnose basiert auf typischer Anamnese und klinisch-neurologischer Untersuchung der Hände. Zusatzdiagnostik mittels elektrophysiologischer Untersuchung (Neurografie) sowie ggf. bildgebenden Untersuchungen (Nervensonografie oder MRT).
- Therapie:Therapie abhängig vom Schweregrad. Konservative Therapie mit Schonung, nächtlicher Schienung oder Kortikosteroidinjektion. Operative Therapie mit Spaltung des Retinaculum flexorum eher bei schweren Verläufen oder Therapieversagen. Spontane Remissionen in 20–30 % der Fälle, insbesondere bei jungen Frauen.
Allgemeine Informationen
Definition
- Das Karpaltunnelsyndrom (KTS) ist das häufigste Nerven-Engpass-Syndrom, bei dem es zu einer Druckschädigung des N. medianus im Karpaltunnel an der Handwurzel kommt.1-5
Häufigkeit
- Häufigste periphere Nervenschädigung und häufigstes Nervenkompressionssyndrom1,5
- Inzidenz von 3–4 Fällen pro 1.000 Einw. pro Jahr5
- Prävalenz von 3,7–10,6 % der Bevölkerung2-3,5
- Häufigkeitsgipfel im Alter zwischen 40 und 60 Jahren5
- Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer (ca. 72 % der Fälle).2,4-6
Ätiologie und Pathogenese
- Bei Nervenkompressionssyndromen kommt es durch chronische Druckschädigung eines peripheren Nervens in einer anatomischen Engstelle zu Missempfindungen sowie sensiblen oder motorischen Ausfallerscheinigungen.
Anatomische Verhältnisse
- Karpaltunnel
- Anatomischer Raum, der dorsal von den Handwurzelknochen und ventral vom Karpalband (Retinaculum flexorum) begrenzt wird.
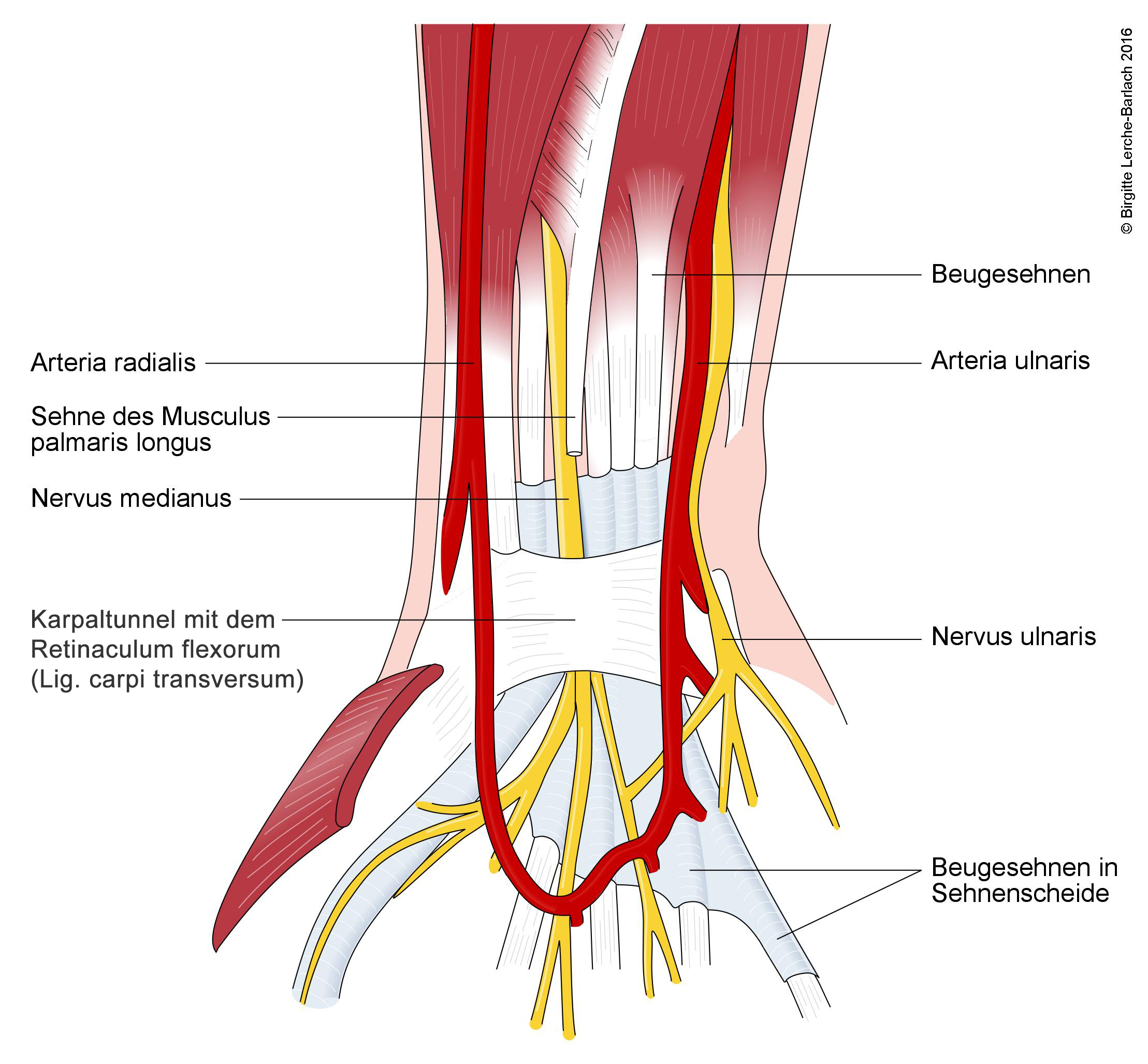 Karpaltunnel
Karpaltunnel - Führt den N. medianus und die Sehnen der Beugemuskulatur der Hand.
- Anatomischer Raum, der dorsal von den Handwurzelknochen und ventral vom Karpalband (Retinaculum flexorum) begrenzt wird.
- Versorgungsgebiet des distalen N. medianus
- sensible Innervation
- Palmarseite der Finger I–III und radialseitig des Fingers IV (Daumen bis Ringfinger)
- radialseitige Handinnenfläche
- Das Handgelenk wird radialseitig vom R. palmaris des N. medianus, der schon vor dem Karpaltunnel abgeht, sensibel versorgt.
- motorische Innervation
- Thenarmuskulatur
- M. opponens pollicis
- M. abductor pollicis brevis
- M. flexor pollicis brevis
- Mittelhandmuskulatur (Mm. lumbricales der ersten 2 Finger)
- Thenarmuskulatur
- sensible Innervation
Ätiologie2,5
- Ursache ist eine Kompression des N. medianus durch Volumen- und dadurch Druckzunahme im Karpaltunnel.
- Die meisten Fälle werden als idiopathisch gewertet.2,5
- Manifestation im Rahmen anderer Erkrankungen2
- raumfordernde Läsionen: Handwurzelluxation, Radiusfraktur mit Kallusbildung, Arthrose mit Osteophyten, Tumoren, Ganglien, angeborene Fehlbildungen
- metabolische und hormonelle Ursachen: Hypothyreose, Diabetes mellitus, Schwangerschaft, Übergewicht, Niereninsuffizienz
- entzündliche und rheumatische Ursachen: rheumatoide Arthritis, Tendovaginitis, Gicht
- degenerative Ursachen: Handgelenksarthrose
- Hinweise auf familiäre Häufungen2
- Bedeutung der genetischen Komponente noch nicht geklärt
Pathogenese2,5
- Kompression des N. medianus bei seinem Durchtritt durch den Karpaltunnel (Canalis carpi), in dem ein erhöhter Druck herrscht.
- physiologischer Druck im Karpaltunnel: 2–10 mmHg
- Druckerhöhung mit Symptomen: ab ca. 30 mmHg
- Ischämie des Nervs (v. a. Epineurium)
- durch Kompression der Venolen, später auch der Arteriolen
- bei intermittierender Ischämie keine dauerhafte Schädigung mit nur vorübergehenden Symptomen
- bei anhaltender Ischämie Nervenfaserschädigungen (axonaler Verlust), intraneurales Ödem und Vernarbung
- Verlust der Myelinscheide (Demyelinisierung)
- frühzeitige Folge der Kompression
- teils symptomlos, daher mögliche Erklärung für bereits auffällige Nervenleitgeschwindigkeit in der Diagnostik ohne entsprechende Symptomatik5
- Sensible Nervenfasern sind von einer Schädigung durch Kompression eher betroffen als motorische Nervenfasern.3
- Gefühlsstörungen gehen motorischen Ausfällen im Krankheitsverlauf voraus.
- Nächtliche Symptomzunahme (Brachialgia paraesthetica nocturna)
- vermutlich durch ein Abknicken des Handgelenks im Schlaf
Prädisponierende Faktoren
- Körperliche Tätigkeiten3,5-6
- Inzidenz bei körperlich Arbeitenden um das 3- bis 7-Fache erhöht
- KTS gehört zu den häufigsten anerkannten Berufskrankheiten in Europa.
- Bewegungsmuster mit erhöhtem Risiko5-6
- repetitive Beuge- und Streckbewegungen der Hände
- Vibration bzw. Hand-Arm-Schwingungen (z. B. Presslufthammer)
- hoher Kraftaufwand der Hände
- Beispiele für Berufe mit Gefährdung6
- Fließbandarbeit, Fleischverpackung und Geflügelverarbeitung
- Gartenarbeit, Forstarbeit und Landwirtschaft
- Reinigungsarbeit
- Fabrik- und Baustellenarbeit
- professionelle Musiker*innen
- kein Nachweis einer Risikoerhöhung bei Tätigkeiten am Computer,,
- Schwangerschaft und Stillzeit5
- Prävalenz von 5–43 % unter Schwangeren, meist im 3. Trimenon
- Ursache vermutlich vermehrte Flüssigkeitsretention
- üblicherweise spontane Remission innerhalb von Wochen nach der Geburt
- z. T. längere Verläufe oder erst postpartaler Beginn bei stillenden Müttern
- Prävalenz von 5–43 % unter Schwangeren, meist im 3. Trimenon
- Traumata und Frakturen im Bereich des Handgelenks2,7
- v. a. distale Radiusfraktur
- Rheumatoide Arthritis5-6
- vermutlich aufgrund einer Verengung des Karpaltunnels durch Verdickung der Sehnenscheiden und Gelenkkapsel5
- Dialysepflichtigkeit5
- Risiko von 80–90 % bei langfristiger Dialyse
- insbesondere Shuntarm betroffen
- möglicherweise aufgrund Amyloid-Ablagerungen an Sehnen im Karpaltunnel5
- Übergewicht und Gewichtszunahme2
- Diabetes mellitus,
- Exzessiver Alkoholkonsum
- Distale Tendovaginitis und Tendinopathien der oberen Extremität2
- Tendovaginosis stenosans (schnellender Finger)
- Komorbidität in 16–43 %
- Perimenopause und postmenopausale Östrogentherapie
- Multiples Myelom
- Amyloidose
- Hypothyreose (Myxödem)
- Akromegalie
- Längerfristige Kortikosteroidbehandlung
- Genetische Prädisposition2
ICPC-2
- N81 Verletzung Nervensystem, andere
ICD-10
- G56 Mononeuropathien der oberen Extremität
- G56.0 Karpaltunnel-Syndrom
- G56.1 Sonstige Läsionen des N. medianus
Diagnostik
Diagnostische Kriterien
- Diagnosestellung in den meisten Fällen durch typische Anamnese und klinische Untersuchung hinreichend möglich
- z. T. erschwert durch atypische Symptome oder Lokalisation3-4
- Anamnese und Beschwerdebild2-5
- „Einschlafen der Hand“ als typisches Erstsymptom
- Symptome nur oder verstärkt in der Nacht (Brachialgia paraesthetica nocturna)
- Taubheitsgefühl (Hypästhesie), Kribbeln (Parästhesien) und Schmerzen in der Handinnenfläche und den radialseitigen Fingern, später Feinmotorikstörung, Lähmungen (Paresen) und Atrophie des Daumenballens
- Klinische Untersuchung3-4
- im Frühstadium oft unauffällig
- sensible oder motorische Ausfallerscheinungen und Funktionseinschränkungen
- Elektrophysiologische Zusatzdiagnostik6,8
- sensible und motorische Neurografie des N. medianus zum sicheren Nachweis
Differenzialdiagnosen
- Läsion des N. ulnaris5
- Läsion des (unteren) Plexus brachialis5
- Thoracic-outlet-Syndrom
- Polyneuropathien5
- Zervikale Radikulopathie (der Wurzeln C6 oder C7)5
- Erkrankungen des Rückenmarks (z. B. transverse Myelitis, Syringomyelie)
- Erkrankungen des Gehirns (z. B. Schlaganfall, multiple Sklerose)5
- Amyotrophe Lateralsklerose (Motoneuronerkrankung)5
- Ringbandstenose des Daumens (Tendovaginitis de Quervain)3
- Raynaud-Syndrom3
- Polymyalgia rheumatica
- Hyperventilationssyndrom
- Kompartmentsyndrom des Unterarms
Weitere Läsionsorte des N. medianus5
- Läsion am Oberarm
- Ursache z. B. Humerusfraktur, Drucklähmung während des Schlafs („Paralysie des Amants“)
- klinisch motorische Defizite der Pronation und Opposition von Daumen und kleinem Finger sowie „Schwurhand“ beim Versuch eines Faustschluss
- Läsion im Bereich der Ellenbeuge9
- Ursachen z. B. Frakturen, iatrogen (Venenpunktion)
- klinisch ähnlich einem Ausfall am Oberarm
- Pronator-Teres-Syndrom9-10
- Kompression durch Lacertus fibrosus unter dem Musculus pronator teres im Unterarm
- Ursache z. B. exzessive Pro-/Supinationsbewegungen (Schraubendrehen)
- klinisch ähnliche Symptomatik wie das KTS, jedoch häufig Druckschmerz am M. pronator teres und Aggravation durch Pronation und Supination
- Hoffmann-Tinel- und Phalen-Zeichen am Handgelenk negativ
- Läsion des N. interosseus anterior am Unterarm9
- Ursache z. B. Fraktur, Plexusneuritis, auch spontan
- klinisch rein motorische Defizite der tiefen Beuger der Digiti I und II sowie des M. pronator quadratus (Pronation des Handgelenks)
- Läsion im Bereich der Handinnenfläche9
- Ursache oft Mitbeteiligung bei Druckschädigung des N. ulnaris im Rahmen einer „Radfahrerlähmung“
- klinisch Thenaratrophie und ggf. sensible Ausfälle
Anamnese
Verlauf und Lokalisation
- Zeitlicher Verlauf4
- meist Beginn mit intermittierenden Beschwerden und langsame Progredienz
- zunächst vermehrtes Auftreten in der Nacht, anschließend auch tagsüber
- sehr selten akute Verläufe
- Lokalisation2,5,11
- dominante Hand häufiger betroffen
- häufig beidseitige Manifestation (80 %)
- Gefahr der Fehldeutung als HWS-Syndrom oder Polyneuropathie
- dadurch meist einseitige Differenzialdiagnosen (z. B. Schlaganfall) unwahrscheinlich
Beschwerden
- Frühsymptome4
- vorübergehendes, meist nächtliches „Einschlafen“ der Hand und Missempfindungen (Brachialgia paraesthetica nocturna)
-
- typisches Erstsymptom und sehr spezifisch für das KTS
- Besserung der Beschwerden durch Ausschütteln der Hände
- Sensibilitätsstörungen und Schmerzen3-4,6
- Kribbeln (Parästhesien), elektrisierende, z. T. anhaltende Missempfindungen (Dysästhesien), Schmerzen, Taubheit (Hypästhesie)
- Lokalisation: Innervationsgebiet des N. medianus
- Handinnenfläche, vorwiegend radiale Finger (DI–DIII), jedoch auch darüber hinausgehende palmarseitige Symptome
- teilweise auch Taubheit der gesamten Hand
- Schmerzausstrahlung über den Unter- und Oberarm bis zur Schulter möglich
- Beeinträchtigung der Feinmotorik durch Sensibilitätsverlust in den Fingerspitzen (Stereoästhesie)
- Führt zu Verlust der Geschicklichkeit der Hand (z. B. Fallenlassen von Gegenständen).
- Motorische Ausfälle4
- Kraftminderung und Atrophie der Thenarmuskulatur im Spätstadium der Erkrankung
- motorische Einschränkungen funktionell meist wenig relevant
- Fragebögen und Bewertungsskalen
- Können zur Erfassung der subjektiven Beschwerden verwendet werden.
- z. B. „Boston Carpal Tunnel Questionnaire", CTS-6, visuelle Analogskala
Modifizierende Faktoren
- Besserung durch Ausschütteln, Massieren oder kaltes Wasser12
- Verschlechterung durch anhaltende Beuge- oder Streckstellung der Hand
- Verstärkung oft nach körperlicher Arbeit
- z. B. durch repetitive Handbewegungen, Vibrationen,
Risikofaktoren2,5-7
- Trauma und Frakturen
- Schwangerschaft
- Perimenopause
- Medikamentenanamnese (Kortikosteroide, Hormontherapie)
- Metabolische oder rheumatologische Erkrankungen
- Familienanamnese
- Berufliche oder sonstige manuelle Tätigkeiten (belastungsinduziertes KTS)
Klinische Untersuchung
- Untersuchung der oberen Extremitäten, des Nackens und der Schultern
- insbesondere zum Ausschluss anderweitiger Ursachen3
- Allgemeine körperliche Untersuchung bei vermuteter Grunderkrankung
- häufige Komorbiditäten14
- KTS in etwa 10 % Erstmanifestation einer rheumatoiden Arthritis
- Tendovaginosis stenosans (schnellender Finger) in 16–43 % der Fälle
- Thoracic-outlet-Syndrom
- häufige Komorbiditäten14
- Im Frühstadium der Erkrankung häufig unauffälliger Untersuchungsbefund
- Inspektion und Palpation
- Sollte zur Erkennung einer Muskelatrophie im Seitenvergleich erfolgen.
- Muskelatrophie des lateralen Daumenballens (Thenar) im Spätstadium der Erkrankung
- verminderte Schweißsekretion bei vegetativer Nervenschädigung (selten)
-
Prüfung der Sensibilität
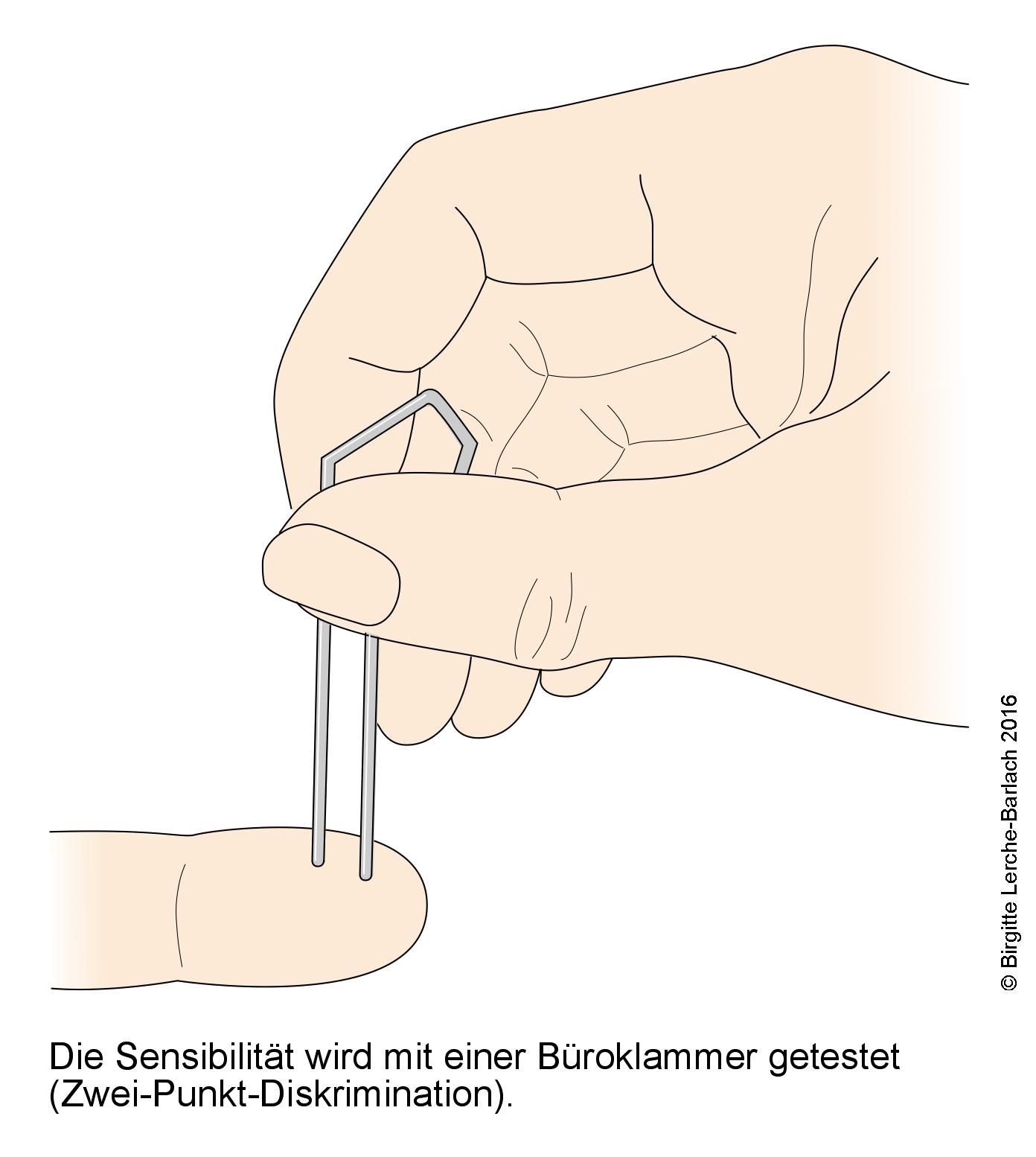 Zweipunktediskrimination
Zweipunktediskrimination
- Oberflächensensibilität
- Prüfung durch Berührung mit Wattebausch
- herabgesetzte Sensibilität im Versorgungsgebiet des N. medianus (Handinnenfläche vom Daumen bis zum Ringfinger)
- Stereoästhesie
- Prüfung der Zweipunktediskrimination
- Ertasten und Erkennen von Objekten (z. B. Münze, Büroklammer)
- Oberflächensensibilität
- Prüfung der Motorik
- Abduktions- und Oppositionsschwäche des Daumens sollte beachtet werden.
- „Flaschenzeichen“: Objekt (z. B. Flasche) kann aufgrund der Lähmung nicht vollständig umfasst werden.
- guter Indikator einer motorischen Beteiligung
- Provokationstests
- Können fakultativ angewandt werden.
- Phalen-Test und Hoffmann-Tinel-Zeichen
Provokationstests
- Fakultative Tests mit eher untergeordnetem diagnostischem Wert5
- Hoffmann-Tinel-Zeichen
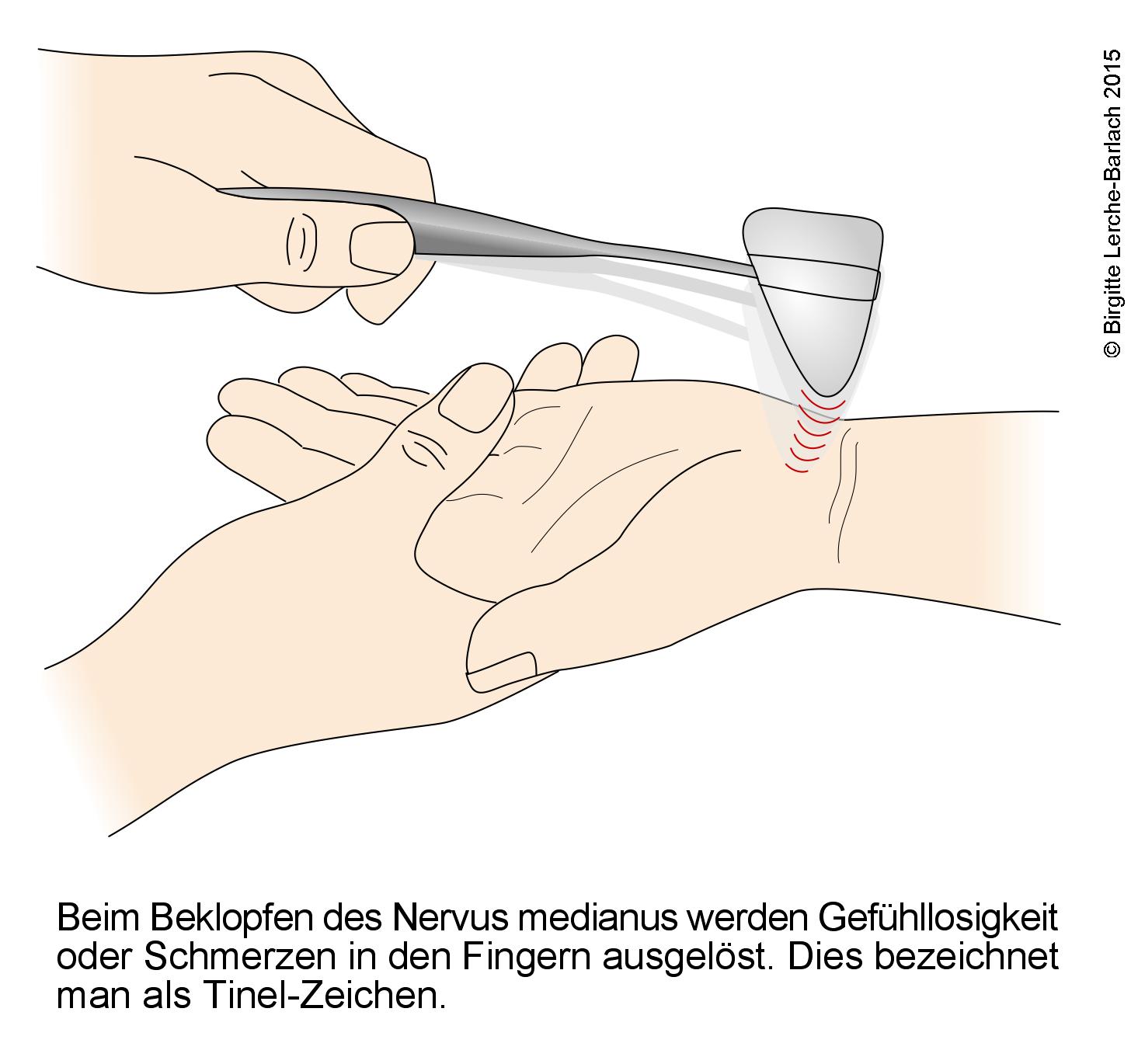 Hoffmann-Tinel-Zeichen
Hoffmann-Tinel-Zeichen- Sensitivität von 38–100 % und Spezifität von 55–100 %4
- Beklopfen des Handgelenks über dem Karpaltunnel2-3
- bei positivem Zeichen elektrisierende Missempfindungen entlang des Verlaufs des N. medianus bis in die Fingerspitzen3
- allgemeines Zeichen für Nervenschädigungen (auch bei anderen Nervenläsionen)
-
Phalen-Zeichen
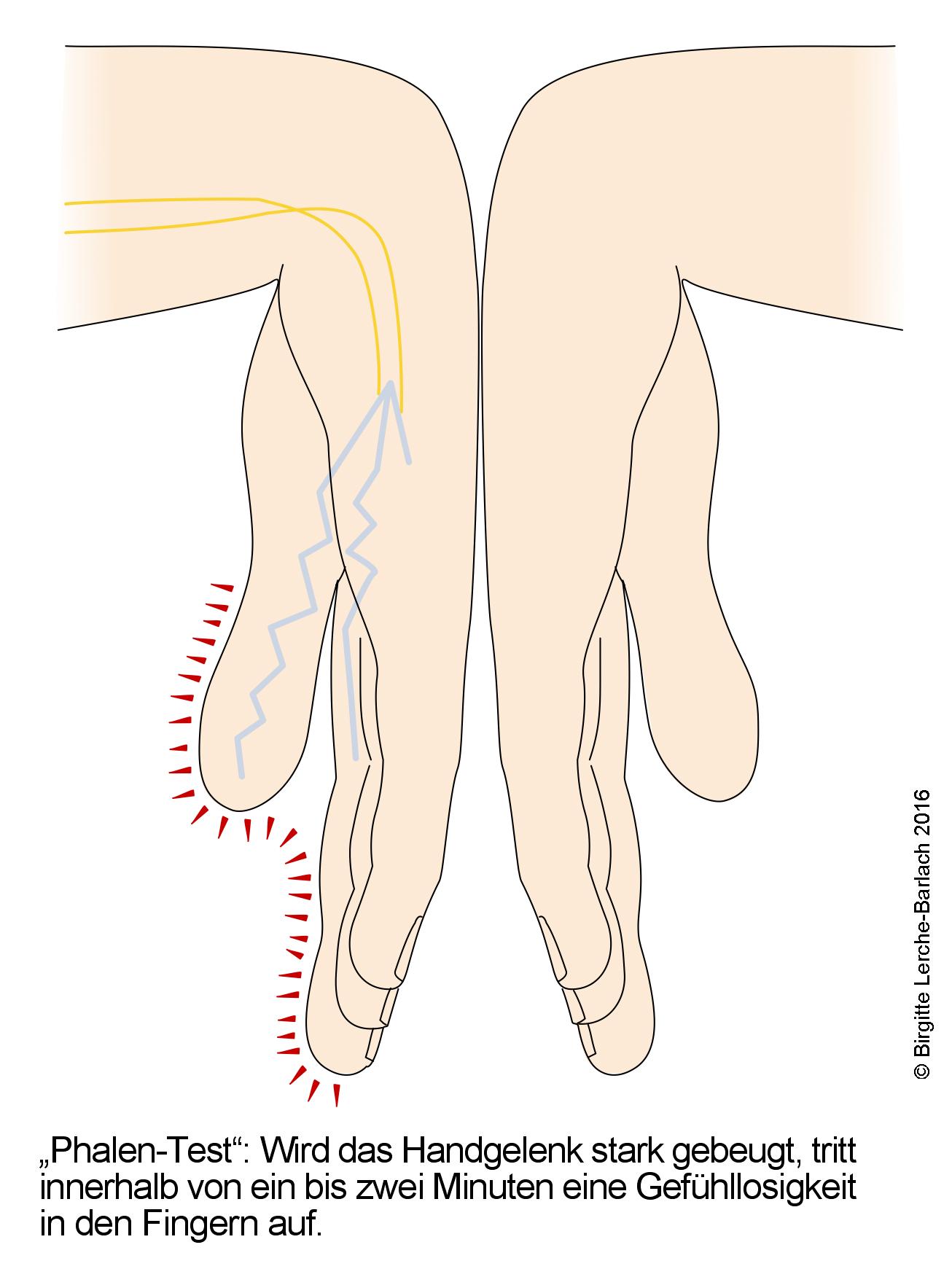 Phalen-Test
Phalen-Test
Diagnostik bei Spezialist*innen
Elektrophysiologische Diagnostik
- Elektroneurografie (ENG)15
- Soll als relevante Methode zum zuverlässigen Nachweis eines KTS durchgeführt werden.
- sensible und motorische Neurografie zur Bestimmung der Nervenleitgeschwindigkeiten (NLG) und Amplituden
- Leitbefund: reduzierte Nervenleitgeschwindigkeit des N. medianus im Karpaltunnel als Folge der Demyelinisierung
- Elektromyografie (EMG)
- routinemäßig nicht erforderlich
- Kann zum Nachweis einer axonalen Läsion oder bei technischen Schwierigkeiten durchgeführt werden.
- Untersuchung des M. abductor pollicis brevis zum Nachweis von Denervierungszeichen
Weitere Zusatzdiagnostik
- Röntgenuntersuchung des Handgelenks
- Kann bei klinischem Verdacht auf Arthrose oder knöcherne Veränderungen erfolgen.
- MRT- oder CT-Untersuchung des Handgelenks
- Kann in begründeten Fällen (z. B. Tumorverdacht) durchgeführt werden.
- MRT mit Sensitivität von 72–96 % und Spezifität von 33–74 % für das KTS
- Hochauflösende Nervensonografie
- Kann zur Diagnostik des KTS eingesetzt werden.
- Sensitivität von 74 % und Spezifität von 77 % in Metaanalyse
- stark abhängig von der Erfahrung des Untersuchers
- Nachweis möglicher zystischer Raumforderungen im Karpaltunnel (z. B. Ganglion)
Indikationen zur Überweisung
- Bei intermittierenden Beschwerden, die länger als etwa 4–6 Wochen anhalten oder anhaltenden Beschwerden Überweisung an Neurolog*innen.10
Therapie
Therapieziele
- Symptomatik (Schmerz, Sensibilität, Motorik) verbessern.
- Funktionelle Einschränkungen der Hand verbessern.
- Irreversible Schädigung (z. B. Muskelatrophie) verhindern.
- Arbeitsunfähigkeit vermeiden.
Allgemeines zur Therapie
- Therapeutisches Vorgehen abhängig vom Schweregrad des KTS3,5,7
- Indikation zur Therapie bei häufigen oder anhaltenden typischen Beschwerden
- Bei 20–30 % der Betroffenen kommt es zu einer spontanen Besserung.
- Entscheidung zwischen konservativer und operativer Therapie
- Kriterien, die für eine konservativen Therapie sprechen:
- Frühstadium der Erkrankung (z. B. nächtlichen Parästhesien)
- junge Patient*innen und Schwangere
- behandelbare Grunderkrankung
- mögliche Anpassung der Auslöser (z. B. manuelle Tätigkeiten, Beruf).
- Kriterien, die für eine operative Therapie sprechen:
- ausbleibender Behandlungserfolg unter konservativer Therapie
- beeinträchtigende Schmerzen oder Parästhesien
- anhaltende sensiblen und/oder motorischen Ausfallserscheinungen
- funktionelle Einschränkung der Hand
- akute, rasch progrediente Verläufe (seltene, absolute OP-Indikation).
- Kriterien, die für eine konservativen Therapie sprechen:
Konservative Therapie
- Anlegen einer Handgelenksschiene in der Nacht
- Soll im Rahmen der konservativen Therapie erfolgen.
- gute Evidenzlage
- Lokale Injektion von Kortikosteroiden
- Kann im Rahmen der konservativen Therapie erfolgen.
- ultraschallgesteuerte Infiltration von Kortikoid-Kristallsuspension in den Karpaltunnel mit geringer Komplikationsrate
- Mehrfachinjektionen nicht empfohlen
- in der Langzeitwirkung der Schienung und Operation unterlegen aber bessere Wirksamkeit als orale Kortikosteroide16-18
- Orale Kortikosteroidtherapie
- Kann im Rahmen der konservativen Therapie erfolgen.
- Anwendung auf 2 Wochen begrenzt
- „Low-Level-Laser“-Therapie
- Kann im Rahmen der konservativen Therapie versucht werden.
- unzureichende Evidenz bezüglich klinischer Wirksamkeit in einer Cochrane-Metaanalyse19
- Konservative Behandlungsverfahren ohne Bewertung
- lokale Ultraschalltherapie
- unzureichende Evidenz in einer Cochrane-Metaanalyse20
- Medikamente ohne anhaltenden signifikanten Effekt
- NSAR, Diuretika, Vitamin B6-Präparate
- Yoga, Handwurzelmobilisation, Nervengleitübungen, Magnettherapie
- lokale Ultraschalltherapie
Entlastung und Schienung des Handgelenks
- Manuelle Schonung und Entlastung des Handgelenks1,5,7
- insbesondere Vermeidung auslösender Tätigkeiten (z. B. im Beruf)
- Schienung des Handgelenks in der Nacht2,5,21-25
- Handgelenk in neutraler Position (0 Grad) oder seltener 20-Grad-Extension
- abhängig vom Schweregrad über 4 Wochen bis 3 Monate
- z. T. eingeschränkte Akzeptanz aufgrund des beeinträchtigten Schlafkomforts
- Wirksamkeit nach 12 Monate gegenüber alleiniger Schonung
- bei ausgeprägter Symptomatik der Operation unterlegen
- Häufig eingesetzt bei Schwangeren, da sich die Symptome postpartal zurückbilden.
Operative Therapie
- Operative Behandlung bei entsprechender Indikationsstellung den konservativen Maßnahmen eindeutig überlegen
- Ziel der Operation: vollständige Spaltung des Retinaculum flexorum
- Öffnung des Karpaltunnels und Dekompression des N. medianus
- Schonung der Nn. medianus und ulnaris und ihrer Äste
- Durchführung der Operation
- in der Regel ambulante Operation
- beidseitiger Eingriff in einer Sitzung möglich
- Operationsverfahren mit vergleichbaren klinischen Ergebnissen26
- offene Operation mit Spaltung des Retinaculum flexorum
- endoskopische Spaltung des Retinaculum flexorum
- Eine Rekonstruktion des Retinakulum kann erfolgen.
- Verletzungen des motorischen Astes des N. medianus sollen ausgeschlossen werden.
- Endoskopische Eingriffe und kleine offene Zugänge sollten nur durch erfahrene Operateur*innen durchgeführt werden.
- ggf. operative Mitbehandlung von Begleiterkrankungen
- z. B. Ringbandspaltung bei Tendovaginosis stenosans
- Komplikationen bei beiden Verfahren in der Größenordnung von 1 %
- Funktionelle Nachbehandlung mit Bewegungsübungen soll ab dem ersten postoperativen Tag erfolgen.
- Arbeitsunfähigkeit nach Operation bei regulärem Verlauf 3–6 Wochen
Anerkennung als Berufskrankheit
- In Europa liegt das Karpaltunnelsyndrom auf Rang 6 der Häufigkeit anerkannter Berufskrankheiten.
- Tritt ein Karpaltunnelsyndrom im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit auf (repetitive manuelle Tätigkeiten mit Beugung und Streckung der Handgelenke, erhöhter Kraftaufwand der Hände oder Hand-Arm-Schwingungen), kann dieses als Berufskrankheit anerkannt werden.
- Es wird eine ausführliche Arbeits- und Gefährdungsanamnese erhoben, und ein Gutachten entscheidet über die Anerkennung als Berufskrankheit.
- Dann können bestimmte Maßnahmen auf Kosten der GUV durchgeführt werden:
- geeignete Schutzvorrichtungen
- spezielle therapeutische Maßnahmen
- Einstellung der gefährdenden Tätigkeit
- Minderung der Erwerbsfähigkeit bis zur Zahlung einer Rente.
- Manchmal muss die Tätigkeit erst vollständig aufgegeben werden, damit die Anerkennung als Berufskrankheit erfolgen kann.
Verlauf, Komplikationen und Prognose
Verlauf
- Der Verlauf des Karpaltunnelsyndroms variiert.5-6
- milde, intermittierende Symptome mit Phasen der Beschwerdefreiheit
- schwere Verläufe mit progredienten und anhaltenden Defiziten
- Spontane Besserungen (20–30 %) kommen insbesondere bei jungen Frauen (vermutlich hoher Anteil schwangerschaftsassoziierter KTS) vor.5,7
Komplikationen
- Irreversible Schädigung des N. medianus mit persistierender Symptomatik
- Funktionelle Einschränkung der Hand4
- Komplikationen der Operation3-5
- Nervenläsionen (< 0,5 % der Eingriffe)
- N. medianus, N. ulnaris und deren Äste
- Wundinfektionen
- komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS)
- extrem selten
- inkomplette Spaltung des Retinaculum flexorum
- häufigste Ursache einer ausbleibenden Besserung der Beschwerden
- protrahierte Narbenschmerzen oder -empfindlichkeit4
- vermutlich durch Ausbildung schmerzhafter Neurome im Narbenbereich
- in der Regel Besserung nach spätestens 6 Monaten
- Rezidive nach anfänglicher Beschwerdefreiheit
- Nervenläsionen (< 0,5 % der Eingriffe)
- Rezidive (< 5 % der Fälle)5,27
- Ursachen: Vernarbungsvorgänge, knöcherne Veränderungen, rheumatische Synovialitis und Chondrokalzinose (v. a. bei Dialyse)
- erneute Diagnostik, konservative Therapie und ggf. operative Revision
Prognose
- Spontane Remissionen in bis 20–30 % der Fälle5,7
- bei Schwangeren meist postpartale Remission innerhalb von Wochen
- Insgesamt gute Prognose bei frühzeitiger Diagnosestellung und Behandlung
- auch in höherem Lebensalter (> 70 Jahre), bei Diabetes mellitus oder bei Dialysebehandlung
- Behandlungseffekt nach konservativer Therapie5
- Verbesserung durch nächtliche Schienung in etwa 70 % nach Wochen bis Monaten
- Verbesserung durch lokale Kortikosteroidinjektion in 60–70 % nach 6 Monaten
- Langzeiteffekte der konservativen Therapien der Operation unterlegen
- Behandlungseffekt nach Operation3,5,28
- Erfolgsraten der Operation von 80–90 %
- meist sofortige Besserung der Schmerzen, langsam rückläufige Sensibilitätsstörung (Tage bis Wochen) und Besserungen bis zu 1 Jahr postoperativ möglich
- Muskelatrophie oft nicht mehr rückbildungsfähig
- Ein langes Intervall (> 3 Jahre) zwischen Symptombeginn und Operation verschlechtert die Prognose.
Patienteninformationen
Patienteninformationen in Deximed
Illustrationen
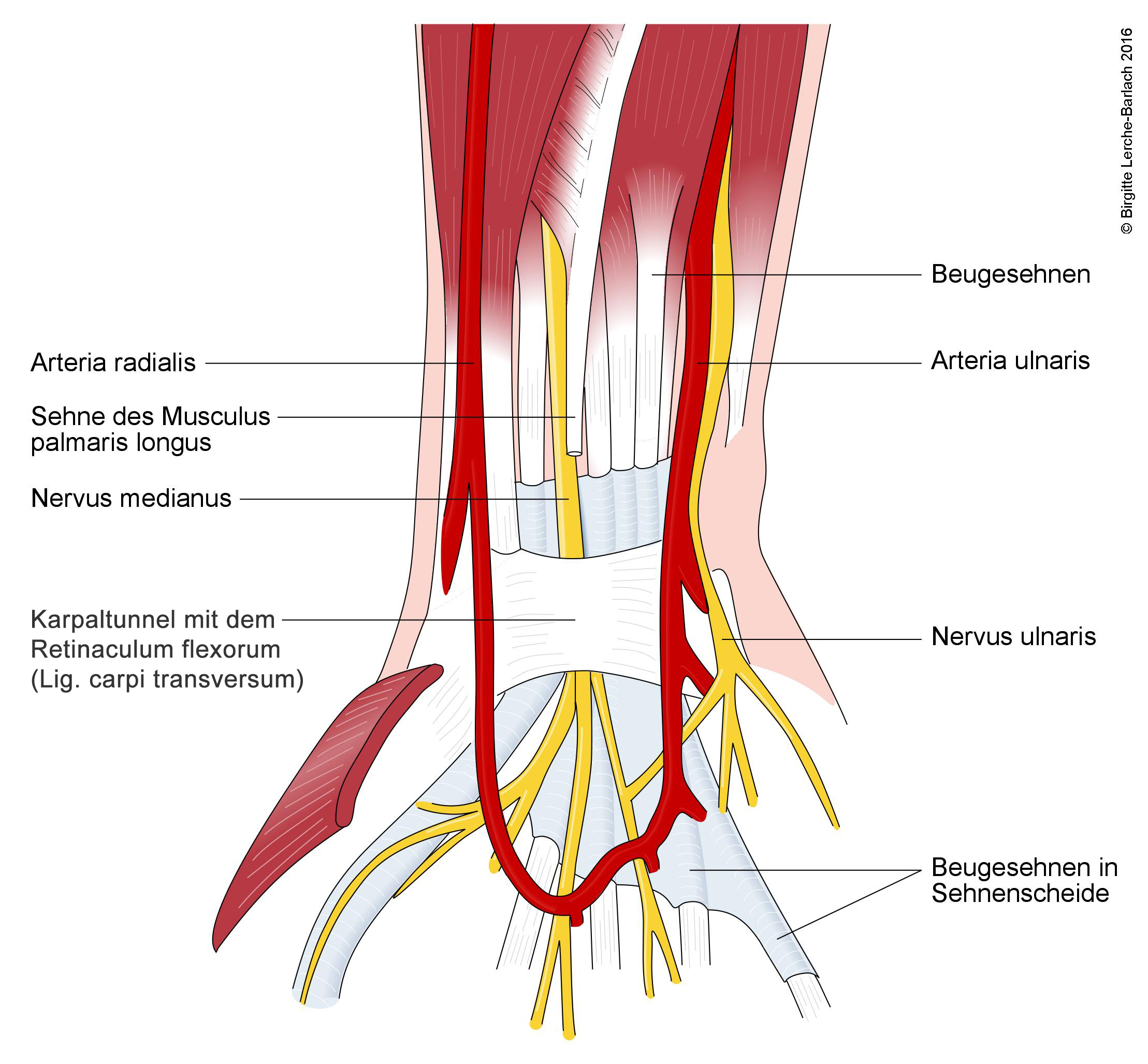
Anatomie des N. medianus beim Durchtritt durch den Karpaltunnel
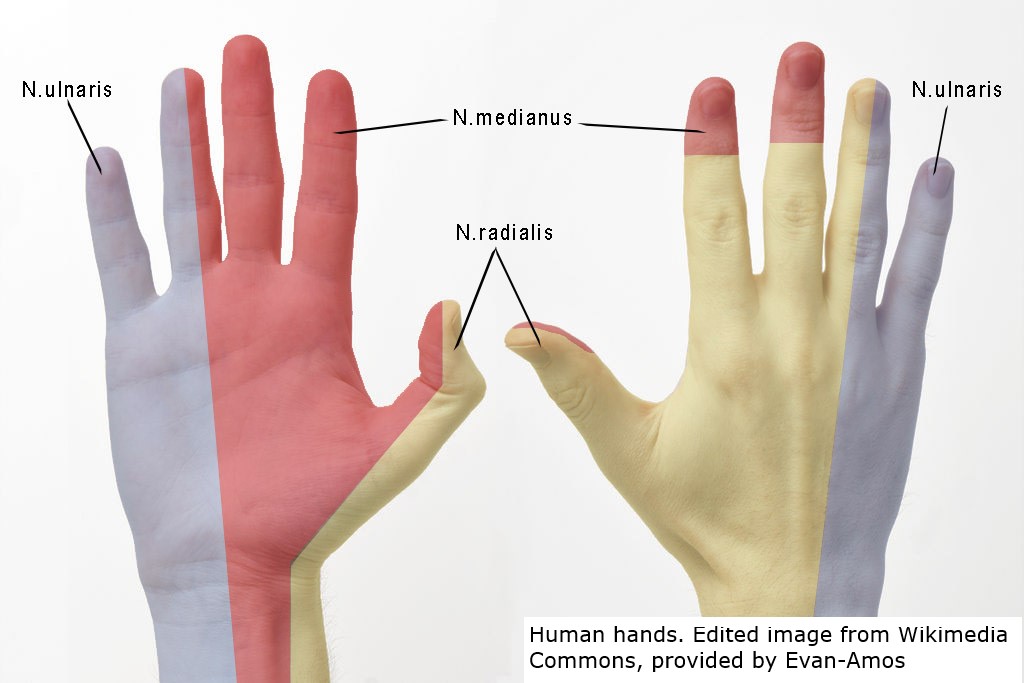
Sensible Innervation der rechten Hand (Quelle: Wikimedia Commons)
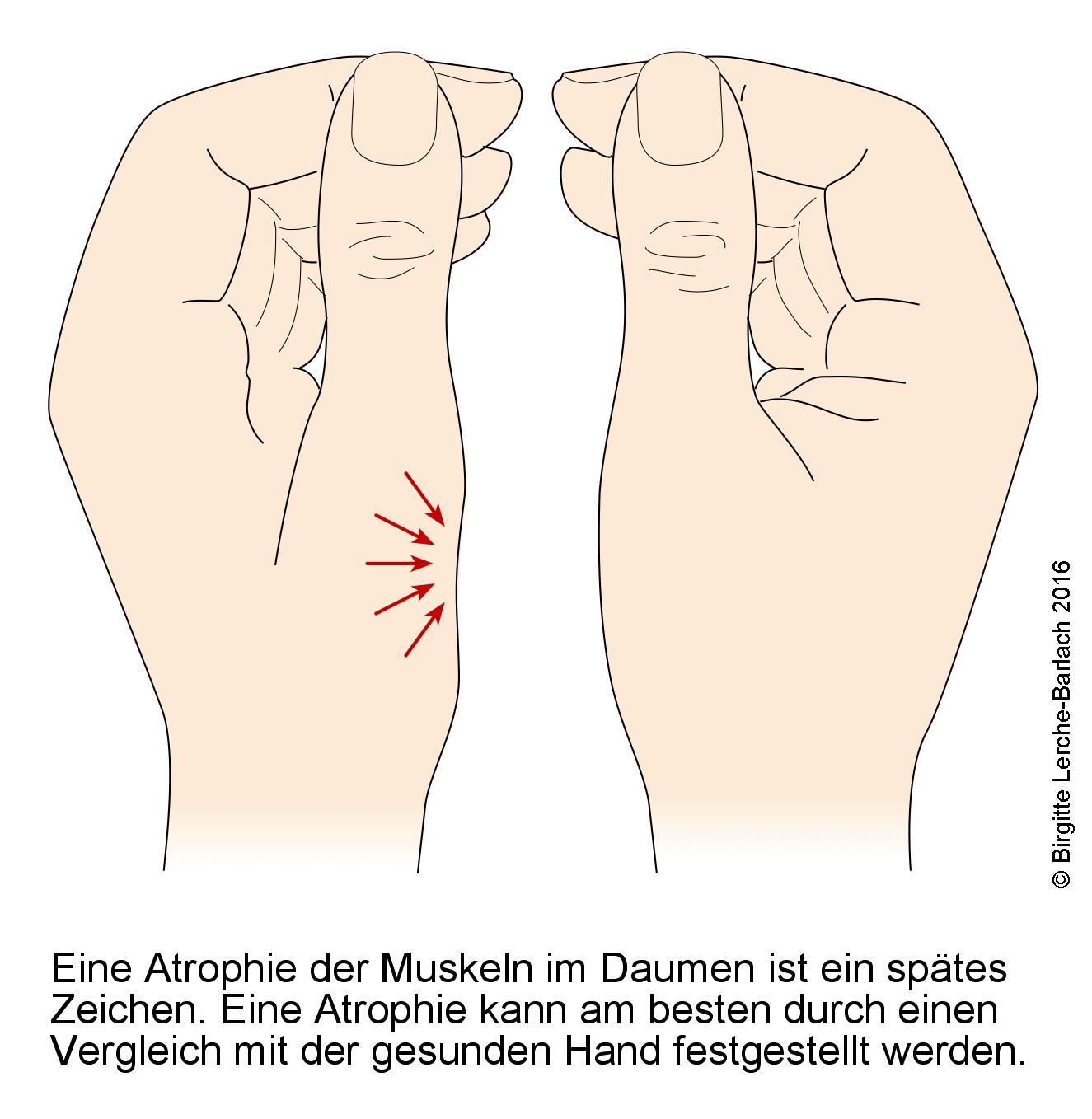
Muskelatrophie der Thenarmuskulatur
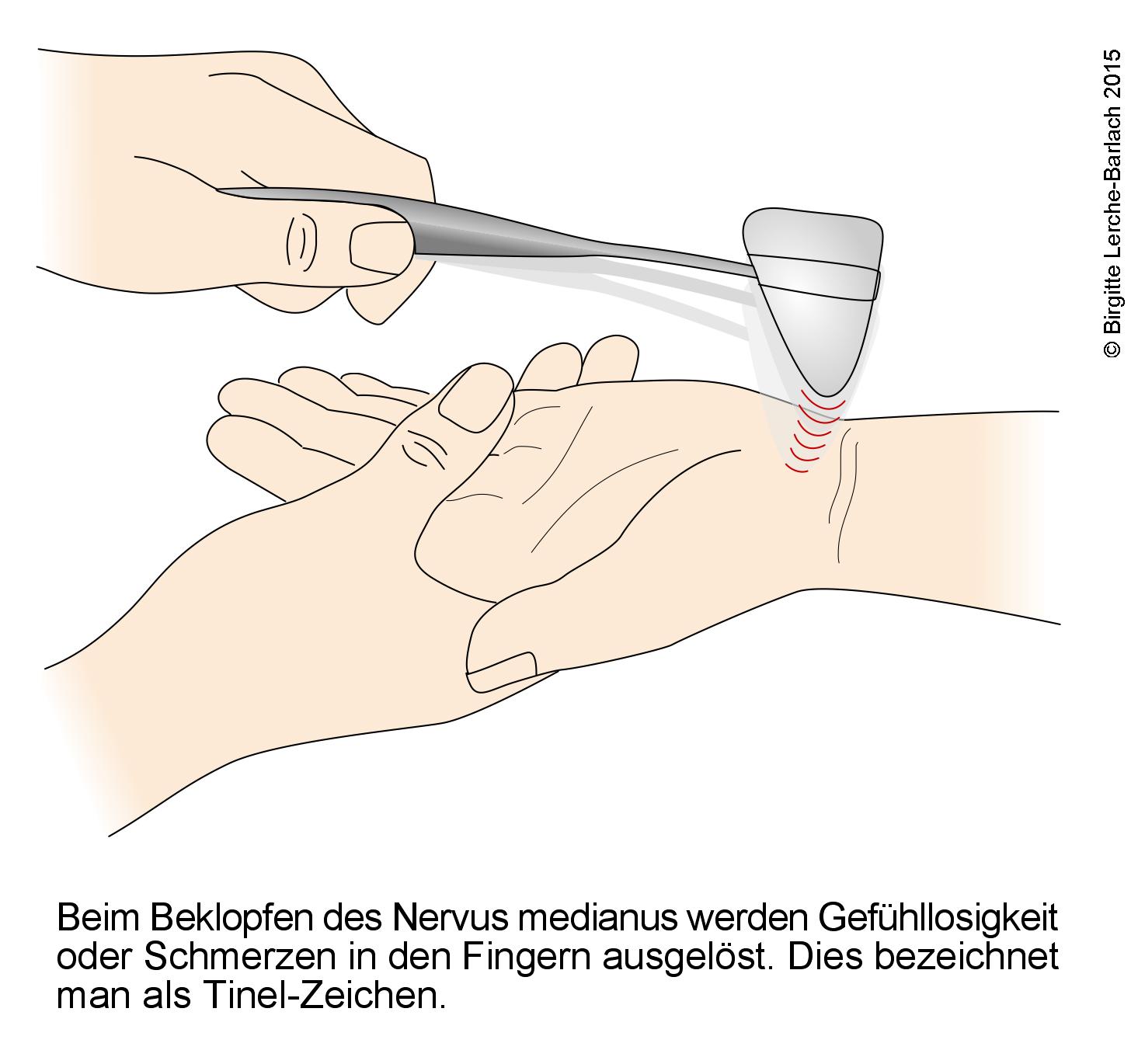
Hoffmann-Tinel-Zeichen
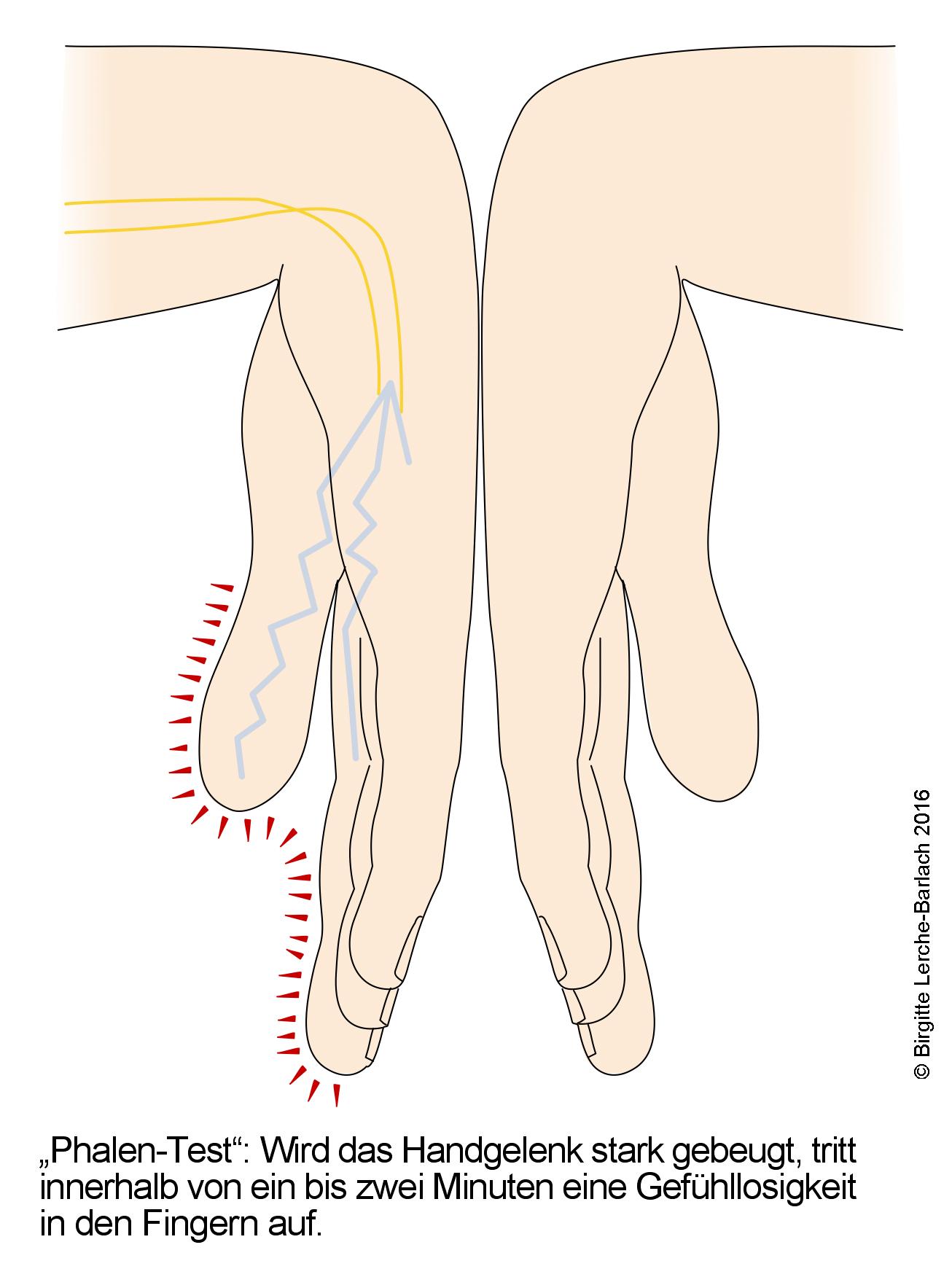
Phalen-Test
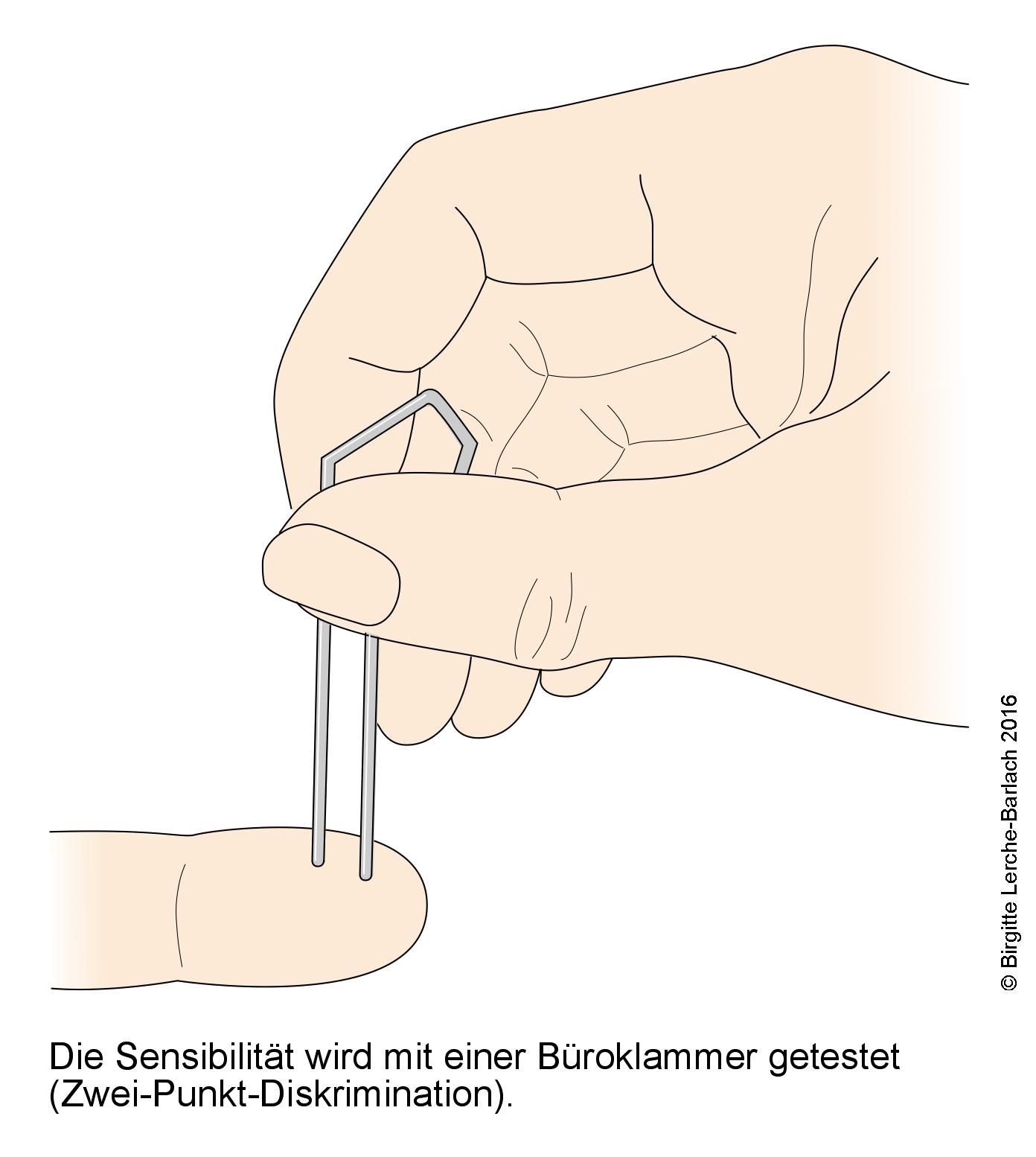
Prüfung der Zweipunktediskrimination
Quellen
Literatur
- LeBlanc KE, Cestia W. Carpal Tunnel Syndrome. Am Fam Physician 2011; 83: 952-8. American Family Physician
- Middleton SD, Anakwe RE. Carpal tunnel syndrome. BMJ. 2014;349:g6437. doi: 10.1136/bmj.g6437. DOI
- Wipperman J, Goerl K. Carpal Tunnel Syndrome: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2016;94(12):993-999. www.aafp.org
- Padua L, Coraci D, Erra C, Pazzaglia C, Paolasso I, Loreti C, Caliandro P, Hobson-Webb LD. Carpal tunnel syndrome: clinical features, diagnosis, and management. Lancet Neurol. 2016 Nov;15(12):1273-1284. pmid:27751557 PubMed
- BMJ Best Practice. Carpal tunnel syndrome. Last reviewed: 6 Jun 2022. Last updated: 23 Oct 2019. (letzter Zugriff am 06.07.2022) bestpractice.bmj.com
- American Academy of Orthopaedic Surgeons. Management of Carpal Tunnel Syndrome Evidence-Based Clinical Practice Guideline. Published February 29, 2016. aaos.org
- Hughes R. Peripheral nerve diseases: The bare essentials. Practical Neurology 2008; 8: 396-405. PubMed
- Jablecki CK, Andary MT, Floeter MK et al. Practice parameter: Electrodiagnostic studies in carpal tunnel syndrome. Report of the American Association of Electrodiagnostic Medicine, American Academy of Neurology, and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology 2002; 58: 1589-92. PubMed
- Preston D C, Shapiro B E. Electromyography and Neuromuscular Disorders, 4th Edition. Elsevier: , 2020. www.eu.elsevierhealth.com
- Neal SL, Fields KB. Peripheral nerve entrapment and injury in the upper extremity. Am Fam Physician 2010; 81: 147-55. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Bland JD, Rudolfer SM. Clinical surveillance of carpal tunnel syndrome in two areas of the United Kingdom, 1991-2001. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74: 1674-9. PubMed
- D`Arcy CA, McGee S. Does this patient have carpal tunnel syndrome? JAMA 2000; 283:3110-17. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Bland JD. Carpal tunnel syndrome. BMJ. 2007 Aug 18;335(7615):343-6. Review. PubMed PMID: 17703044 www.ncbi.nlm.nih.gov
- Vaught MS, Brismée JM, Dedrick GS, et al.. Association of disturbances in the thoracic outlet in subjects with carpal tunnel syndrome: a case-control study. Journal of hand therapy 2011; 24: 44-52. PubMed
- American Association of Electrodiagnostic Medicine, American Academy of Neurology, and American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Practice parameter for electrodiagnostic studies in carpal tunnel syndrome: summary statement. Muscle Nerve. 2002 Jun;25(6):918-22. PubMed PMID: 12115985 www.ncbi.nlm.nih.gov
- Marshall SC, Tardif G, Ashworth NL. Local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD001554. DOI: 10.1002/14651858.CD001554.pub2 www.cochranelibrary.com
- Wong SM, Hui AC, Lo SK, Chiu JH, Poon WF, Wong L. Single vs two steroid injections for carpal tunnel syndrome: A randomized clinical trial. Int J Clin Pract 2005; 59: 1417-21. PubMed
- Atroshi I, Flondell M, Hofer M, et al. Metyhylprednisolone injections for the carpal tunnel syndrome: A randomized, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 2013; 159: 309-17. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Rankin IA, Sargeant H, Rehman H, Gurusamy KS. Low‐level laser therapy for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD012765. DOI: 10.1002/14651858.CD012765. www.cochranelibrary.com
- Page MJ, O'Connor D, Pitt V, Massy‐Westropp N. Therapeutic ultrasound for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD009601. DOI: 10.1002/14651858.CD009601.pub2. www.cochranelibrary.com
- Muller M, Tsui D, Schnurr R, Biddulph-Deisroth L, Hard J, MacDermid JC. Effectiveness of hand therapy interventions in primary management of carpal tunnel syndrome: a systematic review. J Hand Ther 2004; 17: 210-28. PubMed
- McClure PS. Evidence-based practice: an example related to the use of splinting in a patient with carpal tunnel syndrome. Hand Ther 2003; 16: 256-63. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Page MJ, Massy‐Westropp N, O'Connor D, Pitt V. Splinting for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD010003. DOI: 10.1002/14651858.CD010003. www.cochranelibrary.com
- Shrivastava N, Szabo RM. Decision making in the management of entrapment neuropathies of the upper extremity. J Musculoskeletal Med 2008; 25: 278-89. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Piazzini DB, Aprile I, Ferrara PE, et al. A systematic review of conservative treatment of carpal tunnel syndrome. Clin Rehabil 2007; 21: 299-314. PubMed
- Vasiliadis HS, Georgoulas P, Shrier I, Salanti G, Scholten RJPM. Endoscopic release for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD008265. DOI: 10.1002/14651858.CD008265.pub2. www.cochranelibrary.com
- Mosier BA, Hughes TB. Recurrent carpal tunnel syndrome. Hand Clin. 2013 Aug;29(3):427-34. doi:10.1016/j.hcl.2013.04.011 Epub 2013 Jun 27. Review.PubMed PMID: 23895723 www.ncbi.nlm.nih.gov
- Atroshi I, Larsson G-U, Ornstein E, Hofer M, Johnsson R, Ranstam J. Outcomes of endoscopic surgery compared with open surgery for carpal tunnel syndrome among employed patients: randomised controlled trial. BMJ 2006; 332: 1473-6. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Autor*innen
- Jonas Klaus, Arzt in Weiterbildung, Neurologie, Hamburg